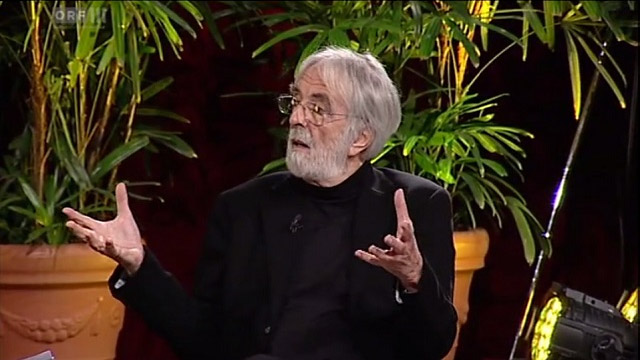Mitschrift
Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von der Wien Holding.
Die Wiener Vorlesungen aus dem Wiener Rathaus. Heute mit der Frage "Staatsschulden: Wer ist schuld? Wer zahlt?". Zu Gast bei Hubert Christian Ehalt sind Ewald Nowotny, Gertrude Tumpel-Gugerell und Walter Ötsch.
Hubert Christian Ehalt, Wiener Vorlesungen: "Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Die Wiener Vorlesungen haben heute ein brandheißes Thema, von dem der eine, die andere in jeder Weise betroffen ist. Die Wirtschaftstreibenden, die Aktionärinnen und Aktionäre, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Konsumentinnen und Konsumenten, die Pensionistinnen und Pensionisten. Es geht heute um Staatsschulden. Es geht um die Frage: Wer hat sich in dem Umfang verschuldet? In Griechenland, in anderen Ländern der EU. Und wer wird die Rechnung bezahlen? Manche von Ihnen, die Älteren, haben das live erlebt. Über Staatsschulden konnte Bruno Kreisky vor 40 Jahren noch seinen berühmten Sager anbringen: 'Wenn mich einer fragt, wie denn das mit den Schulden ist, dann sage ich ihm das, was ich immer sage: dass mir ein paar Milliarden mehr Schulden weniger schlaflose Nächte bereiten als ein paar hunderttausend Arbeitslose mir bereiten würden.' Man sieht aus dem Zitat, dass sich Politik, Prioritäten und Perspektiven seither massiv verändert haben. Griechenland hat ein massives Staatschuldenproblem, von dem noch nicht klar ist, wie es die Europäische Union verkraften wird, wie es den Zusammenhalt der Union betreffen wird und wie es die Bonität des Euro betreffen wird. Auch andere Staaten sind von diesem Problem betroffen. Österreich, wie wir wissen, hat zuletzt ein Sparpaket beschlossen, das in einigen Bereichen doch Einschnitte machen wird. Wir haben ein sehr prominentes Podium für die Diskussion, das die Problemlage aus einer theoretischen Perspektive und in der Praxis aus erster Hand kennt. Das ist der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank Ewald Nowotny, die ehemalige Vize-Gouverneurin des Internationalen Währungsfonds und Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank Doktorin Gerti Tumpel-Gugerell und Herr Professor Walter Ötsch. Er ist Professor an der Johannes-Kepler-Universität in Linz und er nimmt sich ganz besonders diesem Verhältnis von Wirtschaft und Politik an. Danke, Herr Gouverneur, Frau Direktor, Herr Professor, dass Sie zu uns gekommen sind. Ein Faktum ist jedenfalls empirisch sehr sicher: Das Handelsvolumen der Finanzwirtschaft ist im Verhältnis auf jenes der Realwirtschaft unendlich gewachsen in den letzten 20 Jahren. Ich habe mich informieren lassen, dass heute nur ein Zehntausendstel der Handelswerte um reale Wirtschaftsgüter geht, alles andere - zehntausendmal mehr - betrifft nicht reale Werte der Finanzwirtschaft. Die Realwirtschaft, die das produziert, was die Menschen brauchen, was sie konsumieren, scheint zu einem Spielball des Finanzkapitals geworden zu sein. Sind wir da, Herr Ötsch, schon bei einem Hauptproblem über das wir heute reden, bei einer wesentlichen Ursache der aktuellen Staatsschuldenkrise?"
Walter Ötsch, Johannes Kepler Universität Linz: "Danke für die Einladung. Ich möchte tatsächlich die Staatsschuldenproblematik, die jetzt diskutiert wird, im Zusammenhang mit der großen Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008 sehen. Und ich möchte gerne mit dieser Grafik starten, die Sie hier oben sehen. Diese Grafik bringe ich deswegen gerne, wenn ich über solche Dinge rede, weil man in den Medien manchmal hört: 'Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Der Sozialstaat ist nicht finanzierbar.' Und das zeigt die Zeitlinie - ich hoffe, Sie können auch die dünnen Linien zeigen - es zeigt die Staatsschulden in Prozent des BIP für alle 17 Euro-Länder und dann ist noch United Kingdom dabei zum Vergleich. Die Zeitspanne geht los von 1999. 1999 wurde der Euro als Buchgeld eingeführt. Die zweite Linie, die rote Linie ist 2002, seit daher haben wir den Euro als Bargeld. Sie erinnern sich vermutlich noch. Und ich habe hier jetzt noch 2007 eingezeichnet, praktisch den Vorabend der großen Finanz- und Wirtschaftskrise. Ich möchte diese Phase von 2002 bis 2007 in zwei Teile unterteilen. Am Anfang sind die Maastricht-Kriterien, man könnte sagen, etwas lax gehandhabt worden. Ungefähr ab November 2003 haben dann verschiedene Defizitverfahren gestartet - Deutschland war viermal dran. Wenn man diese Phasen sieht, praktisch die letzten Jahre vor der Krise, dann kann man zeigen - und die empirischen Daten sind sehr, sehr eindeutig -, dass die Staatsschulden im Prozent des BIP im Trend fast in allen Ländern gefallen sind. Auch ein Problemland wie Griechenland, die obere orange Linie hat sich erhöht, aber nicht dramatisch erhöht, das heißt, wir können mit Festigkeit sagen: Es hat vor Ausbruch der großen Finanz- und Wirtschaftskrise kein strukturelles Problem gegeben für die Staatsschulden, es hat keine Finanzierungsproblematik gegeben - die einzelnen Länder wurden relativ einheitlich bewertet. Es hat bestimmte Unterschiede gegeben in den Spreads, aber die waren nicht sehr groß. Was ist nachher passiert? Nachher hat sich die Situation dramatisch verändert - die große Krise 2009. 2009 haben wir im Euro-Raum, im EU-Raum im Durchschnitt einen Einbruch des Wirtschaftswachstums, also ein Minus von ungefähr 4,2 Prozentpunkten gehabt. In Österreich war es ein bisschen weniger, in anderen Ländern war es viel, viel größer. Wir haben einen Sozialstaat. Sozialstaat bedeutet, wenn das Wirtschaftswachstum geringer ist, wenn das Wirtschaftswachstum zurückgeht, steigen die Ausgaben überproportional, die Einnahmen sinken - zum Beispiel weniger Einkommenssteuer, die Steuer ist ja progressiv - das war der erste Punkt. Der zweite Punkt waren temporäre Konjunkturprogramme, historisch gesehen in sehr, sehr großer Höhe. Der dritte Punkt waren Bankenrettungsprogramme - in manchen Ländern in großem Volumen, in manchen Ländern überhaupt nicht schlagend. Was nachher eingetreten ist, sind drei verschiedene Dinge, nämlich erstens: Die Wachstumsmodelle der Südstaaten, der Südperipherie, die vorher hohe Wachstumsraten gehabt haben - höhere als der Norden zum Teil -, die sind durch die Krise obsolet geworden. Dann hat man bemerkt, dass der Euro-Raum und auch die Konstruktion der EZB, dass es hier Strukturmängel gibt, die vorher nicht schlagend geworden sind. Der wichtigste Punkt - und ich denke über das werden wir heute sicher noch reden - sind die ganz spezifischen, politischen Reaktionen, die dann dieses Problem verschärft haben."
Hubert Christian Ehalt, Wiener Vorlesungen: "Frau Doktor Tumpel, was würden Sie dem noch hinzufügen?"
Gertrude Tumpel-Gugerell, ehem. Vizepräsidentin Internationaler Währungsfonds: "Als erstes vielleicht ein persönliches Erlebnis: Ich habe vor ein paar Jahren mit einer griechischen Kollegin diskutiert und habe ihr gesagt: 'Du, unsere Analysen zeigen, dass bei euch die Gehälter im öffentlichen Dienst zu schnell steigen.' Darauf hin hat sich mir gesagt: 'Was wollt ihr überhaupt? Ich habe nur 900 Euro Pension, das ist eigentlich viel weniger als vergleichbare Kollegen in anderen europäischen Ländern haben.' Vor zwei Jahren, als die Griechenlandkrise voll zum Tragen gekommen ist, hat sie mir dann gesagt: 'Wir sind nicht schuld an diesem Desaster.' Mittlerweile spürt sie natürlich auch sehr die Folgen der Budgeteinsparungen. Was meine ich damit? Staatsschulden sind das Ergebnis demokratischer Entscheidungen. Das was der Professor Ehalt eingangs gesagt hat - nämlich, dass man in den 1970er-Jahren sehr bewusst einem möglichen Wirtschaftseinbruch entgegen gesteuert hat, Mitte der 1970er-Jahre, ist - ich muss sagen, ich bin froh darüber - auch 2008 gemacht worden. Man wollte nicht eine Krise erleben, wie wir sie in den 1930er-Jahren erlebt haben. Man wollte nicht die Arbeitslosigkeit derartig ansteigen lassen. Leider ist das nicht in allen Ländern gelungen. Man weiß, dass in Deutschland, in Österreich mit der Kurzarbeit, die man damals eingeführt hat, ein ärgerer Einbruch der Wirtschaftsaktivität verhindert worden ist. Was sind Staatsschulden? Staatsschulden entstehen entweder, wenn mehr ausgegeben wird als die Steuern hergeben. Entweder, weil man gewisse Tatbestände nicht besteuert oder weil die Steuermoral nicht ausreichend ist. Staatsschulden können auch daraus resultieren, dass staatliche Leistungen erbracht werden, die konzipiert waren für Jahre, wo das Wirtschaftswachstum viel höher war und wo eben die Steuereinnahmen gesprudelt sind. Die können entstehen aus der Konjunktursteuerung, aus der Gegensteuerung von schlechter Konjunktur und auch weil Strukturreformen nicht stattfinden, da möchte ich auch dem Vorredner widersprechen. Natürlich hat man gewisse langfristige Trends, das weiß man auch seit Jahrzehnten. Man weiß, die Zusammensetzung der Bevölkerung nach Altersgruppen wird sich verändern. Aber natürlich sind das sehr unpopuläre Themen oder unpopuläre Maßnahmen und es dauert eine Zeit lang, bis das wirklich angepackt wird. Der fünfte Grund für Staatsschulden ist, wenn in die Zukunft investiert werden kann oder soll. Das ist natürlich ein Thema, wo jeder sagen würde: Das ist doch gut, wenn wir für die Zukunft neue Infrastruktur et cetera aufbauen. Aber wichtig ist, dass das, was in Europa nicht stattgefunden hat, dass wir wahrscheinlich am Beginn der Währungsunion die künftigen Wachstumsraten überschätzt haben. Herr Ötsch hat Recht, wenn er sagt: 'Eigentlich hat es bis 2007 nicht so schlecht ausgeschaut.' Wir haben die Jahre hohen Wachstums nicht genutzt - das Jahr 2000 mit drei Prozent Wachstum - und haben gedacht, es geht so weiter, auch in den nächsten Jahren werden schon höhere Wachstumsraten sein. Das war nicht der Fall, weil es in den USA zu dieser Internetblase gekommen ist, die dann auf Jahre hinaus das Wachstum sehr stark gedämpft hat. Das heißt, es waren schon einige Probleme vorher da. Ohne die Währungsunion hätte es in einigen Ländern noch viel schwieriger ausgeschaut, weil nicht die gemeinsam vereinbarte Zielsetzung da gewesen wäre, die Fiskalpolitik unter Kontrolle zu bringen. Man muss auch sagen: Natürlich haben viele Länder von den niedrigen Zinsen profitiert, die in den Jahren vor der Finanzkrise da waren. Das heißt, es hat vielen geholfen und, was ganz wichtig ist, auch im Hinterkopf zu haben: 2008 hat die Politik richtig reagiert, haben die Notenbanken richtig reagiert, weil massiv gegengesteuert wurde. Das hat aber seinen Preis gehabt und das war die Finanzkrise, die sich niedergeschlagen hat in den Budgetdefiziten, die im Durchschnitt einen ziemlichen Anstieg der Staatsverschuldung gebracht hat und wo dann Finanzinvestoren plötzlich gesagt haben: 'Wir wollen nicht weiterfinanzieren, wir wollen höhere Renditen sehen.' Das heißt, vor Beginn der Krise war wahrscheinlich die Annahme da bei manchen Investoren: Naja, es kann einem Land in der Euro-Zone ja nichts passieren. Das, was dann unerwartet war, dass man im Fall von Griechenland sehr wohl gesagt hat: 'Jetzt schauen wir uns das an - kann Griechenland alleine aus dieser Situation heraus kommen oder braucht es externe Hilfe?' Da wurde dann ein paar Monate lang diskutiert und es hat auch seine Zeit gebraucht bis man auch nationale Parlamente überzeugt hat, dass man hier einen Kredit geben soll. Ich könnt noch näher eingehen auf die einzelnen Phasen, die wir seither erlebt haben. Warum es seit vier Jahren immer noch nicht möglich ist, dass wir dieses Kapitel hinter uns bringen können. Da muss man sich eben bewusst sein, dass wir 2008, 2009 relativ gut wieder aus der Krise herausgekommen sind. Dass aber dann die Schwierigkeiten in einzelnen Ländern massiv geworden sind. Dass Griechenland sein viel höheres Defizit zugeben musste, dass Spanien eigentlich auch in einer schwierigen Lage war, aber durch die Maßnahmen der EZB damals - nämlich, dass Anleihen gekauft wurden von einzelnen Mitgliedsstaaten - Zeit bekommen hat, die eigenen Finanzen wieder stärker unter Kontrolle zu bringen. Aber wenige Monate später sind Portugal und Irland in Schwierigkeiten gewesen. Wir haben einige Male gute Erfolge erzielt bei der Krisenbewältigung und einige Male hat es Rückschläge gegeben. Es ist nicht einfach, dass Europa plötzlich viel enger zusammenrücken musste, weil man viel mehr gespürt hat: Wir sitzen eigentlich in einem Boot und wir müssen gemeinsam nach Lösungen suchen und die müssen wir nicht nur der Welt erklären, sondern wir müssen sie genauso auch unseren eigenen Wählern erklären. Deswegen haben wir gerade wieder eine sehr schwierige Etappe hinter uns. Es ist eine gewisse Erleichterung zu spüren, dass diese Umschuldung für Griechenland gelungen ist, aber insgesamt ist noch ein weiter Weg vor uns."
Hubert Christian Ehalt, Wiener Vorlesungen: "Aber Griechenland ist vielleicht gar nicht so ein exemplarisches Beispiel. Da gibt es doch sehr viele interne Gründe, die jetzt eben schlagend geworden sind, in dieser Griechenlandkrise. Darf ich da noch bei Ihnen nachfragen?"
Gertrude Tumpel-Gugerell, ehem. Vizepräsidentin Internationaler Währungsfonds: "Natürlich ist es immer eine Summe von Ereignissen. Dass Griechenland lange Zeit seine Probleme unter den Tisch gekehrt hat und falsche Statistiken gemeldet hat, ist ein Problem gewesen. Dass aber Griechenland auch eine sehr schwache Wirtschaftsdynamik hatte, die lange Jahre durch eine starke Kreditexpansion auch überdeckt worden ist, ist eine zweite Tatsache. Und das ist etwas, was man nicht von heute auf morgen bereinigen oder beheben kann und das ist eine entscheidende Frage für die Zukunft: Wie kann Griechenland wieder wachsen und wieder zurückkehren zu einer Entwicklung, wo sie auch selbst wieder in der Lage sind internationales Vertrauen zu bekommen?"
Hubert Christian Ehalt, Wiener Vorlesungen: "Fangen wir vielleicht auch da bei dieser Griechenlandkrise an, Herr Gouverneur. Was ist dem noch hinzuzufügen? Gibt es Chancen, dass Griechenland aus dieser Krise, die doch massive, deutliche Indikatoren hat, herauskommt, kurzfristig?"
Ewald Nowotny, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank: "Ich möchte auf diesen Punkt noch eingehen, aber mir ist es wichtig, dass man zunächst einmal einen grundsätzlicheren Aspekt sieht, der auch für diese Veranstaltung heute wichtig ist. Ich glaube, man muss sehr genau unterscheiden zwischen der Rolle des Euro auf der einen Seite und den Problemen einiger Staaten, speziell südlicher Staaten, auf der anderen Seite. Der Euro als Währung ist nicht in der Krise. Der Euro als Währung erfüllt alle Funktionen, die eine Währung zu erfüllen hat. Das ist zum einen als Zahlungsmittel, das ist natürlich unbestritten, als Zahlungsmittel - sowohl im Euro-Raum als auch international, auch als internationale Währungsreserve, etwa 28 Prozent der Weltwährungsreserven werden im Euro gehalten, Tendenz steigend - und das zweite: Er erfüllt die Funktion als Wertaufbewahrungsmittel. Also das heißt: Preisstabilität. Der Euro hat in den zwölf Jahren seines Bestehens eine durchschnittliche Inflationsrate von knapp unter zwei Prozent aufgewiesen. Das ist deutlich weniger als in den zehn Jahren vorher beim Schilling oder bei der D-Mark. Das heißt, der Euro funktioniert, es gibt keine Euro-Krise. Aber es gibt eine Krise einzelner Staaten, einzelner südlicher Staaten und die ist wieder unterschiedlich zu sehen, weil es natürlich - wie vorhin gesagt - unterschiedliche Ursachen gibt. Aber im Wesentlichen - das muss man schon deutlich sagen - im Wesentlichen hängt es damit zusammen, dass das Staaten sind, die im doppelten Sinn Ungleichgewichte hatten. Sie hatten Ungleichgewichte in ihrer Leistungsbilanz - das heißt, sie haben mehr importiert als sie exportiert haben und das musste immer irgendjemand finanzieren. Das heißt, sie müssen dafür Kredite aufnehmen. Und sie haben Ungleichgewichte gehabt in ihrem Budget, das heißt, sie brauchen auch immer Geld um ihr Budgetdefizit zu finanzieren. Diese Kumulierung, dieses Zusammentreffen - und in Griechenland hatten wir zeitweise Budgetdefizite von acht Prozent, Leistungsbilanzdefizite von zehn Prozent - das ist ganz offensichtlich nicht dauerhaft durchführbar. Das braucht eine Korrektur. In diesem Ausmaß, wenn es so groß ist wie in Griechenland, ist es eine Korrektur, die von den Märkten selber nicht mehr zu schaffen ist. Schlicht und einfach: Niemand ist mehr bereit, Griechenland Geld zu borgen. Das heißt, es ist von den Kapitalmärkten abgeschnitten und daher ist ja auch für Griechenland vorübergehend ein entsprechendes Hilfsprogramm gemacht worden. Man muss ganz klar sagen, das kann immer nur für eine bestimmte Zeit sein und daher muss ich in der Zwischenzeit Strukturanpassungen vornehmen, die dazu führen, dass sich letztlich hier dieses Land selber finanzieren kann. Diese Strukturanpassungen sind zunächst einmal sehr schmerzhaft, sehr restriktiv, aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass kann es nicht alleine sein. Also nur durch Restriktion wird ein Land nicht aus der Krise kommen. Es muss eine Kombination sein von restriktiven Maßnahmen, wo eben tatsächlich zum Teil durch zu niedrige Zinssätze Griechenland ein Scheinwachstum gehabt hat, das nicht real begründet war. Zum anderen müssen es auch expansive Maßnahmen sein. Es ist ja hier die Idee - klingt ein bisschen hochtrabend - eines speziellen Marshall-Plans für Griechenland, das heißt de facto von Investitionen. Es hat die Europäische Investitionsbank hier ein entsprechendes Programm entwickelt. Wobei es aus meiner Sicht für Griechenland besonders wichtig ist, dass es attraktiv wird für ausländische Direktinvestitionen. Weil, das ist der Typ von Investitionen, der einen wirklichen Strukturwandel bringt, der gleichzeitig auch Exportmärkte mit sich bringt und dafür muss ich aber auch attraktiv sein. Das heißt, dafür muss ich funktionierende Verwaltungsstrukturen haben, dafür muss ich eine funktionierende Infrastruktur haben, das sind alles die Voraussetzungen, an denen jetzt gearbeitet wird und ich hoffe, mit Erfolg."
Hubert Christian Ehalt, Wiener Vorlesungen: "Herr Gouverneur Nowotny, Sie sind ja auch Wirtschaftsprofessor und jetzt möchte ich in der Runde auch eine ganz grundsätzliche Frage stellen. Dieses in den letzten 20 Jahren massive Anwachsen der Finanzwirtschaft hat doch die gesamte Wirtschaft in ziemliche Turbulenzen gebracht. Ich stelle die Frage auch an die anderen Kollegen am Podium - wie schaut denn in einer longue durée dieses Verhältnis von Finanzwirtschaft und realer Wirtschaft aus? In welchem Ausmaß war das produktiv? Vermutlich war die Finanzwirtschaft in der europäischen Geschichte ja schon ein wichtiger Innovationsimpuls, aber bei einem Verhältnis, wo die Realwirtschaft in Hinblick auf tatsächlich stattfindende Geschäfte nur mehr ein Zehntausendstel des Volumens ausmacht, die reale Wirtschaft. Das kann doch für ein gesamtgesellschaftliches System von Erzeugung und Handel und Konsum nicht gut sein. Wie sehen Sie das?"
Ewald Nowotny, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank: "Die Finanzwirtschaft hat ja wichtige volkswirtschaftliche Funktionen. Eben, dass ich in der Lage bin, Investitionen zu finanzieren, damit langfristige Wirtschaftsentwicklung zu erreichen. Natürlich auch, dass ich im Konsumbereich - jeder von Ihnen, der sich eine Wohnung gekauft hat, hat wahrscheinlich einmal einen Kredit aufgenommen - das heißt in dem Sinn, das sind produktive Funktionen. Aber es ist heute, glaube ich, unbestritten, dass es in diesen letzten 20 Jahren Fehlentwicklungen gegeben hat oder Entwicklungen gegeben hat, die zu Problemen geführt haben - manche Fehlentwicklungen, manche unvermeidlich. Eine unvermeidliche Entwicklung ist der Bereich der Globalisierung. Es gibt keinen Wirtschaftsbereich, der so globalisiert ist wie der Finanzbereich. Wir haben die Finanzmärkte liberalisiert, daher haben wir die Finanzströme jetzt quasi international frei flottierend und das bedeutet, dass damit die Unsicherheit der Finanzierung sehr viel größer geworden ist. In früheren Zeiten etwa konnte der italienische Staat sicher sein, seine Staatsschulden finanziert zu bekommen, weil italienische Sparkassen klarerweise immer italienische Staatsanleihen gekauft haben. Heute ist das nicht mehr sicher der Fall, weil ich eben als italienische Sparkasse, als Kapitalanleger weltweit mein Kapital investieren kann und damit natürlich die Ausschläge sehr viel größer sind. Das ist die eine Entwicklung. Die andere Entwicklung ist die, dass es unter dem Einfluss von ökonomischen Theorien, die heute ja zum Teil durchaus problematisch erscheinen, zu einer massiven Entwicklung der Deregulierung gekommen ist. Finanzmärkte sind ja Märkte, die besonders sensibel sind, daher müssen sie auch ein besonderes Maß an Regulierung haben. Es hat hier Theorien gegeben von optimal funktionierenden Märkten, spezielle Alan Greenspan, der Gouverneur der Amerikanischen Notenbank, war ein sehr starker Vertreter dieser Theorie. Und damit sind viele Regulierungen weggefallen. Das hat sich als negativ erwiesen. Also der unmittelbare Anlasspunkt der Krise, die wir jetzt hier erlebt haben, war eine massive Deregulierung der amerikanischen Immobilienfinanzierung. Das hat dann eine Krise ausgelöst, das waren alles nicht mehr solide Bereiche. Das war nicht naturgegeben. Es ist interessant zu sehen: Kanada, ein Land, das eine ähnliche Struktur hat wie die USA, hat nie in dem Ausmaß dereguliert. Und in Kanada hat es keine Krise der Immobilienfinanzierung gegeben. Das heißt, das sind schon politische Entscheidungen. Und jetzt sind wir ja dabei zu re-regulieren. Jetzt kommt wieder ein neuer Regulierungsbereich, man kann vielleicht sogar sagen, dass, was man früher zu viel dereguliert hat, hat man jetzt die Gefahr ein bisschen zu viel zu re-regulieren. Das geht ja immer so in Schwankungen, die Wirtschaftspolitik. Das heißt, es gibt quasi ökonomische Entwicklungen, aber es gibt auch sehr starke institutionelle Entwicklungen und da wurden - das muss man offen sagen - sicherlich Fehler gemacht."
Hubert Christian Ehalt, Wiener Vorlesungen: "Gibt es für die Re-Regulierung überhaupt eine Chance? An so einer neuen Regulierung müssten ja im Grunde alle beteiligt sein, Herr Ötsch."
Walter Ötsch, Johannes Kepler Universität Linz: "Ich denke, wir sind jetzt bei einem ganz wichtigen Thema gelandet, nämlich: in welcher Weise, in welchem Gesamtbild dieses Systems, man könnte das Finanzkapitalismus oder Finanzmarktkapitalismus nennen, wenn wir die Staatsschuldenkrise in diesem System definieren, dann denke ich, bräuchten wir letztlich einen langen historischen Blick, wo wir verschiedene Aspekte beschreiben, wie sich dieses System verändert hat. Das ist natürlich nicht nur eine Veränderung auf der ökonomischen Ebene, es ist auch eine Veränderung auf der politischen Ebene, enorme Machtkonzentrationen, wachsende Ungleichheit, die die Ursache und Wirkung ist, der riesige Bereich von Steuer- und Regulierungsoasen, wo substanzielle Teile des Kapitalismus unsichtbar geworden sind, Schattenbanken, ungeregelte Derivatmärkte und so weiter. Natürlich bedeutet ein solches System auch Machtverschiebungen. Es ist auch schon angesprochen worden, dass eine der Triebkräfte für diese Transformation - das ist eigentlich über mindestens drei Jahrzehnte gegangen - ökonomische Theorien waren. Das heißt, ökonomische Theorien, die gesagt haben: 'Märkte sind per se selbst regulierend, sie gleichen sich aus. Und genau die Finanzmärkte sind jene Märkte, die das am besten machen. Das heißt, wir können hier der Kreativität von Bankern, von Investoren immer neue Produkte zu erfinden, die brauchen wir nicht regulieren, es gibt keine großen Gefahren.' Die Krise im Herbst 2008 hat einen Schock ausgelöst. In diesem Schock wurde versprochen, zum Beispiel auch von Politikern oder zum Beispiel bei der G20-Tagung im November 2008, dort hat es geheißen: Jedes einzelne Finanzmarktinstrument, jeder Finanzmarkt wird neu und substanziell reguliert. Wir haben jetzt eine große Regulierungsdebatte - man könnte jetzt das Ganze im Detail beschreiben - in den USA, im europäischen Raum. Substanziell ist noch nicht viel passiert im Großen und Ganzen und was wir jetzt beobachten könnten ist, dass diese Denkweise Deregulierung per se gut zu heißen - eine bestimmte Denkweise, die in der Ökonomie 'Angebotstheoretische Denkweise' heißt - dass die kurze Zeit zurückgedrängt war. Das heißt, man hat diese Konjunkturrettungsprogramme gemacht - Sie haben das erwähnt. Aber, was letztlich jetzt passiert, ist, dass wieder diese Denkweise im Vordergrund ist. Das heißt, man nimmt sich ein Problem, wie zum Beispiel die Staatsschulden, heraus, diskutiert das relativ isoliert, sagt: 'Dieses Problem muss bereinigt werden', man disgradiert aber nicht den Zusammenhang letztlich mit den Fragen, die auch angesprochen sind, zum Beispiel mit den Zahlungsbilanz-Ungleichgewichten oder Leistungsbilanz-Ungleichgewichten. Das heißt, diese Art von Wachstumsmodellen - das ist ja schon gesagt worden - in einzelnen Ländern, man hat letztlich keine Art von Wachstumsperspektive. Man hat auch auf EU-Ebene die Berechnungsproblematik verschärft, man hat zum Beispiel das strukturelle Defizit enger gefasst. Vereinfacht gesprochen könnte man sagen: Die Denkweise, die eine der Ursachen zur Krise war, diese Denkweise diktiert jetzt diese Spargesinnung. Was möglich ist oder was wir uns nicht erhoffen, dass das eine Rezension nach unten in einzelnen Ländern auslöst, und was wir viel mehr bräuchten, wäre eine sehr forcierte Debatte über das Gesamtsystem oder auch im Hintergrund - das ist, denke ich, auch eine Sorge: Was vom Sozialstaat wollen wir retten? Draghi hat gesagt: Der Sozialstaat ist überholt. Wir wollen den sozusagen aushebeln. Das heißt, dass wir diesen Rahmen retten und dazu brauchen wir eine Debatte über das Gesamtsystem. Wir brauchen eine Debatte über Wachstumsproblematik und wir brauchen eine Debatte über sehr neue Arten von Regulierung, dass dieses Finanzmarktsystem gezähmt wird."
Hubert Christian Ehalt, Wiener Vorlesungen: "Frau Doktor Tumpel, Sie haben ja über Ihre Tätigkeit bei der Europäischen Zentralbank auch Einblick, wie jetzt neue Denkansätze, wie sie Herr Gouverneur Nowotny und Herr Ötsch skizziert haben, auch umgesetzt werden. Gibt es dieses Diktum, dass der Markt ein ganz gerechtes oder das gerechteste Einrichtungssystem von Wirtschaft und Gesellschaft ist? Gibt es in Europa da schon eine Gegenperspektive, die sich in den zaghaften Versuchen nach neuen Regulierungen sichtbar macht?"
Gertrude Tumpel-Gugerell, ehem. Vizepräsidentin Internationaler Währungsfonds: "Erstens möchte ich noch einmal ganz kurz darauf eingehen, warum die Finanzmärkte so groß geworden sind und so eine große Rolle bekommen haben. Das Erste ist, dass die einzelnen Länder oder Regionen unausgewogene Politik gemacht haben. Das heißt, einige Länder haben Überschüsse erwirtschaftet, wie zum Beispiel China, andere Länder waren sehr abhängig davon, wie die USA, im Ausland Kredite aufzunehmen. Dazu ist gekommen, dass, wenn Sie große Pensionssysteme mit Kapitalansparen finanzieren, große Beträge auch zur Veranlagung da sind, die dann in Zeiten niedriger Zinsen auch durchaus bereit sind in riskantere Veranlagungen zu gehen. Das Dritte ist, dass sich die Geschwindigkeit, mit der heute Kapitalanlagen umgeschlagen werden, weitergereicht werden, investiert werden, enorm erhöht hat. Zusätzlich ist auch eine Art von Auffassung gekommen, dass man zum Beispiel ein Haus in manchen Regionen - nicht nur in den
USA, sondern auch in Europa - finanzieren kann, wenn man ganz wenig Eigenkapital hat und man bekommt einen Kredit von 120 Prozent des Wertes des Hauses. Das ist einfach eine Regel fürs Finanzwesen, die einfach zu locker ist. Es ist nicht vorsichtig genug zu sagen: 'Das Haus ist 100 wert, 120 kriegst du Kredit.' Weil das einfach viel zu viele Menschen dazu verführt einen Kredit aufzunehmen. Wir brauchen mit den Finanzmarktregeln ja gar nichts Neues erfinden. Das, was wir derzeit machen, ist etwas, das es schon gab. Es hat auch deswegen nach dem Krieg relativ wenige Finanzkrisen gegeben, weil die Banken sehr stark reguliert waren. Sie waren so stark reguliert, wo man in den 1980er-Jahren gesagt hat: 'Vielleicht ist es unsinnig, wenn ich einer Wiener Bank nicht erlaube in Niederösterreich eine Filiale aufzumachen.' Aber man hat damals auch Regeln gehabt, die haben nicht erlaubt, dass man mit kurzfristigem Geld ganz langfristige Veranlagungen macht, wie es in den letzten Jahren der Fall war. Das heißt, man konnte nicht nur mit Marktliquidität, nur mit kurzfristigem Geld, das einem eine andere Bank oder ein anderer Anleger geborgt hat, ganz langfristige Veranlagungen machen. Das heißt, wir führen zum Teil wieder Regeln ein, die es schon gab - genauso mit der Liquidität. Das heißt, es ist ein Wachstumsbeschränkungsmodell, das jetzt eingeführt wird, für den Finanzsektor - wo es immer eine Befürchtung gibt, auch von den europäischen Notenbanken. Was wir nicht haben wollen, ist, dass Kredite beschränkt werden, dort, wo sie gebraucht werden für Investitionen, für realwirtschaftliche Aktivitäten. Das ist eine ganz feine Gradwanderung. Es ist heute zum Beispiel von der europäischen Kommission ein Papier veröffentlicht worden zum Thema Schattenbanken - ganz schwieriges Thema. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man hier auch Regulierungen oder letztlich Regeln einführt. Bisher ist dieser Bereich, der mittlerweile halb so groß ist wie das Banksystem selbst, unreguliert. Es ist wichtig, dass man hier Maßnahmen ergreift, damit man wieder mehr Stabilität im System hat."
Hubert Christian Ehalt, Wiener Vorlesungen: "Die alten Regulatorien sind ja verloren. Wer erstellt denn die neuen und wie sind die zu sanktionieren, Herr Gouverneur?"
Ewald Nowotny, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank: "Das kann ich nur beurteilen, wenn ich es in einem Gesamtzusammenhang sehe. Da würde ich gerne das noch aufgreifen, weil, das will ich nicht im Raum stehen lassen, vom Kollegen Ötsch. Dieses Zitat des Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi: 'Der Sozialstaat ist überholt.' Ich habe mit ihm selber darüber gesprochen. Das ist nicht als generelle Aussage zu sehen, das hat er für bestimmte Regelungen der Arbeitsmärkte, für bestimmte Regulierungen etwa in den südlichen Staaten inklusive Italien gemeint. Und ich glaube, es ist schon auch wichtig darauf hinzuweisen: Der Sozialstaat, also wenn ich das als das europäische Modell bezeichne, eben mit einem Schwerpunkt auf sozialem Ausgleich, mit einer Verantwortung für Ausbildung und ähnliches, ist aus meiner Sicht überhaupt nicht überholt. Die Staaten, die heute besonders leistungsfähig sind - das sind die skandinavischen Staaten, das ist Deutschland, das ist Österreich -, die entsprechen diesem Modell des europäischen Sozialstaates. Aber was sich schon geändert hat und das ist wichtig zu sehen, das ist die Finanzierung des Sozialstaates. Das heißt, ich glaube, der Sozialstaat als solches ist wichtig, aber er muss solid finanziert werden. Da haben wir natürlich schon gesehen: Ein Sozialstaat, der nur auf Verschuldung aufgebaut ist, der ist gefährdet. Und ich habe das bei anderen Gelegenheiten schon berichtet und erzählt: Eines meiner Schlüsselerlebnisse vor etwa zehn Jahren war ein Gespräch mit dem damaligen schwedischen Finanzminister Göran Persson, der schon damals gesagt hat: 'Ein Staat mit hoher öffentlicher Verschuldung ist nie ein souveräner Staat. Er ist immer abhängig von seinen Gläubigern, von denen, die bereit sind die Anleihen zu kaufen' und damit auch abhängig von den Rating-Agenturen, die hier sozusagen Einfluss nehmen. Die Schweden haben auch entsprechend gehandelt und haben durch eine konsequente Politik die Quote der Staatsverschuldung am Sozialprodukt in den letzten Jahren deutlich herunter gesetzt und sind daher auch unabhängiger. Wenn ich das hier in den Räumen des Rathauses sagen darf, es ist ja ganz interessant zu sehen - diese Sicht, dass ich öffentliche Verschuldung als eine Beschränkung meiner Unabhängigkeit zu sehen habe, ist eine Sicht, die war ganz klassisch für das sogenannte 'rote Wien'. Wenn Sie in Wien an einem der Gemeindebauten vorbei fahren, der Zeit des roten Wiens, dann werden Sie darauf sehen: 'Erbaut aus Mitteln der Wohnbausteuer'. Die ökonomische Idee dahinter war, man will sich öffentliche Leistungen nicht finanzieren lassen durch Schuldaufnahme aus der damaligen Sicht auf den kapitalistischen Finanzmärkten, sondern durch eine solide Besteuerung, das heißt durch Steuermittel. Es ist klar, ich kann Wohnbau nicht allein durch Steuermittel finanzieren, aber man muss ganz deutlich sehen - und auch das Beispiel Skandinavien zeigt das -, es geht nicht darum, dass ich den Sozialstaat abbaue, aber es geht darum, dass ich ihn solid finanziere. Ich glaube, in der Richtung muss man das sehen und umgekehrt, wenn ich zu lange öffentliche Verschuldung zulasse, dann komme ich in die Problematik, dass es zum abrupten Bruch des Sozialstaates kommt. Griechenland ist ein dramatisches Beispiel, Italien, Spanien, und man sieht, wenn ich auf einmal nicht mehr finanzieren kann, dann muss ich in kurzer Zeit unter dem Druck der Märkte auf jeden Fall radikale Maßnahmen setzen. Daher glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man das sieht - gerade, wenn ich einen Sozialstaat funktionsfähig halten will, muss ich für eine ordentliche Finanzierung sorgen und eine langfristig stabile Finanzierung aufbauen. Das ist eine der Lehren, glaube ich, die wir aus dieser Finanzkrise zu ziehen haben."
Hubert Christian Ehalt, Wiener Vorlesungen: "Aber es geht ja auch, wie Sie gesagt haben, dann doch auch immer um große Paradigmen. Und gegenwärtig ist doch das Hauptparadigma der Europäischen Union noch immer die Gerechtigkeit des Marktes und der öffentliche Sektor, der im Grunde ja jene Verantwortung trägt, die ein Sozialstaat braucht für die wichtigen Dinge - für Bildung, für das Gesundheitswesen, für Innovation und Universitäten - wird doch eigentlich verteufelt. Im Grunde ist die Hauptthese, dass ein Hauptproblem der Europäischen Union oder der Staaten, die in Schwierigkeiten sind, darin besteht, dass sie einen zu aufwändigen öffentlichen Sektor haben. Wie sehen Sie das, Herr Ötsch?"
Walter Ötsch, Johannes Kepler Universität Linz: "Ich denke - vielleicht noch zum Herrn Gouverneur - natürlich muss man irgendeine Art von angemessener Finanzierung machen. Natürlich kann nicht das Budgetdefizit unendlich ausgeweitet werden. Die Frage ist nur, wie man es macht. Vielleicht noch einmal zu der grundsätzlichen Frage: Wir bräuchten viel mehr Klarheit, dass dieses System, dieses finanzmarktkapitalistische System in sich ganz grundlegend instabil ist. Und genau in diesem Rahmen agieren wir. Das heißt, wir wissen nicht, ob morgen eine neue Krise kommt, ob eine Krise möglich ist, das heißt genau in diesem Rahmen agieren wir. Ich denke, ein ganz entscheidender Punkt ist, wie man mit diesem System quasi umgeht. Wenn man sich zum Beispiel die deutsche Politik ansieht und Deutschland hat ja im letzten Jahr einen enormen Machtzuwachs erlebt, dann herrscht zum Beispiel eine Rhetorik vor, die Frau Merkel hat es manchmal gesagt, dass sie meint: 'Es ist ja gut, dass es einen Druck auf diese problematischen Länder gibt. Es ist gut, dass diese Art von Disziplinierung passiert.' Das heißt, den Finanzmärkten, die ja im Grunde genommen keine Logik haben, die halt nach irgendeiner Logik funktionieren, wo Panik auftreten kann, wird praktisch eine Art von Mächtigkeit in der Beschreibung zugeordnet. Und sie sagt ja auch zum Beispiel, es geht um eine marktkonforme Demokratie, man hört nicht von einer demokratiekonformen Finanzwirtschaft. In dem Rahmen, wird gesagt, muss sozusagen gespart werden und es wäre ganz etwas anderes zu sagen: Wir machen jetzt ein Sparpaket oder eine Reduzierung und gleichzeitig wird es auf der regulativen Ebene viel weiter getrieben, sodass man positive Aspekte entfalten kann. Was zum Beispiel in Griechenland passiert ist - aufsummiert jetzt von 2009 - haben wir ja ungefähr fast in der Größenordnung von 20 Prozent des BIPs einen Einbruch. Das heißt, wer zahlt das? Das zahlen die armen Leute, das zahlt die Jugend - Jugendarbeitslosigkeit von 50 Prozent. Und im Grunde genommen, wenn jetzt neue Investitionsprogramme kommen, ist das gut, aber es ist schon relativ spät und man hat schon relativ große Opfer. Das heißt, wenn man es sehr pointiert sagen könnte, könnte man sagen: Was jetzt in Europa passiert, ist im Großen und Ganzen eine Politik, wie die Weltbank in den 1990er-Jahren Strukturanpassungsprogramme gemacht hat. Viele Dinge, die gemacht werden - zum Beispiel Senkungen des Mindestlohnes, zusätzliche Flexibilisierung auf den Arbeitsmärkten - ergeben ja an und für sich für die Sparproblematik per se keinen Sinn. Aber es gibt im Rahmen einer Denkweise, wo man glaubt, man kann so Wirtschaft stimulieren, im Rahmen einer angebotstheoretischen Denkweise, da gibt es einen Sinn und das ist sozusagen die große Angst, dass die Sparproblematik, die Finanzierungsproblematik jetzt genau ausgenützt wird, einen Rahmen zu schaffen, auch durch diesen Verfassungsrahmen, wo eine ungeheure Beschränkung auf die Staaten ist und gleichzeitig der Rahmen nicht gesetzt wird und gleichzeitig mit ungeheuer großen Summen die Banken gerettet werden, was ja wieder kurzfristig sinnvoll ist. Das heißt, ich denke, das ist eine Art von Vorteil, der passiert ist. Wir haben ja jetzt vermischt eine Finanzierungskrise bei den Staaten und gleichzeitig eine Bankenkrise. Wenn man sich anschaut, was macht man in Bezug auf die Banken und was macht man in Bezug auf die Staaten, dann ist das natürlich eine ganz, ganz große Diskrepanz. Das heißt nicht, dass man das nicht machen soll, aber im Gesamtrahmen ist das jetzt eine enorme Schieflage. Bei den Banken hat man jetzt diesen Tender gemacht von über einer Billion Euro und in einem anderen Rahmen könnte man natürlich eine völlig unkonventionelle Frage stellen: Könnte man sich ein Programm, wo es eine Billion Euro Kredite gibt, überhaupt vorstellen? Aber nicht jetzt spezifisch für die Banken, sondern zum Beispiel für Klein- und Mittelunternehmen. Was hätte das zu bedeuten? Diese Fragen werden überhaupt nicht diskutiert. Das heißt, es ist ein ungeheuer großer Konsens, der für mich beunruhigend ist. Und auf einer übergeordneten Ebene könnte man sagen, es wird eine Art von Wirtschaftspolitik gemacht, wo es de facto keine Opposition gibt. Das heißt, es gibt de facto keine Opposition, die versucht, dieses System grundsätzlich in Frage zu stellen und zu sagen: Es hätten jetzt schon die drei Jahre genützt gehört, um zu versuchen, dieses inhärente instabile System, das nächstes Jahr irgendwohin ausschlagen könnte und wir wissen es nicht, mehr zu zähmen und dieses System stabiler zu machen. Es gibt viele, viele Vorschläge, wie man das machen kann und es ist noch sehr, sehr wenig umgesetzt."
Hubert Christian Ehalt, Wiener Vorlesungen: "Stichwort Bankenrettung. Hätte es eine Alternative zur Bankenrettung gegeben, Frau Doktor Tumpel?"
Gertrude Tumpel-Gugerell, ehem. Vizepräsidentin Internationaler Währungsfonds: "Nein. Weil wir müssen uns jetzt zurückversetzen in die Situation des Jahres 2008. Im Herbst 2008 haben viele Menschen Zweifel gehabt am Finanzsystem. Viele Menschen haben sich überlegt: Soll ich mein Erspartes jetzt rausnehmen aus der Bank? Was natürlich erst recht zu Problemen geführt hätte und damals haben die Regierungen Folgendes gemacht: Sie haben gesagt: 'Wir garantieren eure Einlagen.' Und das hat zu einer Beruhigung geführt, das hat dazu geführt, dass die Banken letzten Endes stabilisiert werden konnten. Manche haben auch Kapitalzuschüsse gebraucht, manche haben schon zurückbezahlt. Wichtig ist, dass wir dieses Vertrauen ins Finanzsystem nicht nur von der Einlegerseite brauchen, die Banken brauchen dieses Vertrauen auch, dass sie weiter Kredite geben können. Wenn Sie Banken haben, die keine Kredite mehr geben können, weil sie sich selber nicht mehr finanzieren können, dann ist das das Schwierigste für eine Wirtschaft und würgt früher oder später auch die Wirtschaft ab. Genau das war die Situation in Griechenland, dass es wichtig war, dass die Banken weiter in der Früh ihre Schalter öffnen, dass die Wirtschaft weiter funktionieren kann, wenn auch auf geringerem Niveau. Aber alles andere wäre noch ein größeres Problem gewesen. In dem Sinn muss man das, was jetzt begonnen worden ist, nämlich von den Banken mehr Eigenkapital zu verlangen - das haben sie ja schon begonnen aufzubauen - das muss konsequent umgesetzt werden und das, was im europäischen Parlament jetzt an Vorschlägen für die Regulierung liegt, auch das muss umgesetzt werden und nicht ein ewiger Diskussionsprozess stattfinden. Wenn man diese beiden Schritte macht, ist das schon sehr viel. Das Dritte ist, dass man auch verstehen muss, warum die Europäische Zentralbank jetzt eine Billion in den Markt gegeben hat - hätte sie das nicht anders verwenden können? Jetzt muss man sagen: Die Europäische Zentralbank kann immer nur Banken Liquidität zur Verfügung stellen, sie kann nicht Banken sanieren, sie kann auch nicht Staaten sanieren. Sie kann nur dazu beitragen, dass in einer Situation, wo Banken Schwierigkeiten haben selbst finanziert zu werden. Wo zum Beispiel amerikanische Geldmarktfonds hunderte Milliarden Euro abgezogen haben im November letzten Jahres, Dezember letzten Jahres - in so einer Situation kann die Notenbank einspringen. Diese Aktion, dass sie nämlich im Dezember und Februar massiv interveniert hat, hat dazu beigetragen, dass wir derzeit wieder mehr Vertrauen und Zuversicht im System haben. Aber lösen müssen die Probleme die Banken selbst und die Staaten selbst."
Hubert Christian Ehalt, Wiener Vorlesungen: "Was ist dem noch hinzuzufügen, Herr Gouverneur?"
Ewald Nowotny, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank: "Das ist ein großes Thema. Das Problem ist ja, dass wir zwei Dinge zugleich erreichen wollen und müssen. Auf der einen Seite - wie vorhin gesagt - wollen wir, dass die Banken Kredite vergeben, weil die Wirtschaft davon lebt. Diese große Kreditvergabe von der Zentralbank an die Banken war ja mit der Absicht, dass es weitergegeben wird - eben genau, was der Kollege Ötsch gesagt hat - an die Klein- und Mittelbetriebe. Und das ist auch, gerade in der zweiten Tranche, in erheblichem Maß erfolgt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir die Banken selber stabiler haben wollen, gerade auch unter dem Aspekt - eine Bank hat ja zwei Seiten: Sie will bereit sein für Einlagen, das heißt, jemand muss ihr Geld borgen und umgekehrt, die Bank selber borgt wieder Geld her. Das heißt, für die Sicherheit wollen wir eine höhere Kapitalausstattung der Banken - das heißt, wir wollen höhere Eigenkapitalquoten haben. Das ist gerade jetzt mit den sogenannten Basel 3-Regelungen - das heißt, Regelungen, wo Banken jetzt mehr Kapital halten müssen. Und das sind zwei Zielsetzungen, die nicht voll übereinstimmen. Auf der einen Seite, wenn ich natürlich viele Kredite gebe, bin ich expansiv. Auf der anderen Seite, wenn ich höheres Eigenkapital habe, werde ich eher vorsichtig sein und weniger Kredite vergeben. Und in dieser Mischung müssen Notenbanken agieren. Ich glaube, dass wir das in Europa gut geschafft haben. Ich möchte besonders betonen, dass wir in Österreich in der Beziehung erfolgreich waren. Erstens: Kein einziger Österreicher hat auch nur einen Euro bei einem Bankenproblem verloren. Wir hatten nie das Problem, dass irgendwer sein Geld verloren hätte. Zum Zweiten: Wir hätten hier die Kreditversorgung in Österreich entsprechend gesichert. Aber natürlich zum Dritten: Das hat auch einen Preis und der Preis war nicht zuletzt, dass es hier staatliche Hilfen gegeben hat, die allerdings im Laufe der Zeit wieder abzubauen sind. Wir müssen uns bewusst sein - und das ist ja angedeutet worden von der Kollegin Tumpel-Gugerell - wir waren und sind zum Teil noch in einer sehr schweren Krise des internationalen Finanzmarktsystems. Die große Leistung war, dass man im Gegensatz zu den 1930er-Jahren erreicht hat, dass diese Krise sich nicht verselbstständigt, dass es durch Bankenzusammenbrüche dazu führt, dass es eine Negativspirale geht, sondern dass man das stabilisieren konnte mit Mitteln und dadurch aber auch die Wirtschaft insgesamt, auch die Realwirtschaft, stabilisiert wurde. Jede Krisenbewältigung hat ihren Preis, es gibt keine kostenlose Krise. Aber ich glaube, dass wir es vergleichsweise gut geschafft haben."
Hubert Christian Ehalt, Wiener Vorlesungen:"Was kann denn ein kleiner Staat wie Österreich tun? Innovationsförderung, Bildung, Universitäten, Sparen, Schuldenabbau. Was noch, Frau Doktor Tumpel?"
Gertrude Tumpel-Gugerell, ehem. Vizepräsidentin Internationaler Währungsfonds: "Wachstum ist das, was wir allen wollen. Und wenn wir zurückgehen auf das Gründungsdekret oder die Gründungsidee der Europäischen Union ist natürlich wirtschaftliche Dynamik und soziales Wohlergehen der Menschen. Das heißt, die Union selbst hat natürlich zwei Zielsetzungen. Ein einzelnes Land kann zwei Dinge machen - das eine ist: Wachstum entsteht durch Bevölkerungswachstum und Wachstum entsteht durch Innovation. Im Bereich Innovation, Bildungsinvestitionen können wir enorm viel machen. Darum ist es so wichtig diese Bildungsdiskussion mit einer längerfristigen Perspektive zu führen. Sehr ernst zu nehmen, die Probleme, die es gibt in den Schulen, in den Universitäten und in diesen Bereich zu investieren. Weil die Qualifikation ist letzten Endes das Entscheidende, wie wir in fünf, zehn und fünfzehn Jahren oder noch länger da stehen werden."
Hubert Christian Ehalt, Wiener Vorlesungen: "Herr Gouverneur, Sie haben vorher vom 'roten Wien' gesprochen. Brauchen wir nicht eine große, neue Gesellschaftsauffassung, die ein bisschen mehr ist als den Kräften des Marktes die Regulierung dessen, was in der Gesellschaft geschieht, zu überlassen?"
Ewald Nowotny, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank: "Ja, das glaube ich sehr wohl. Weil eine Gesellschaft, die sich als Gesellschaft empfindet, braucht auch ein Gefühl der Gerechtigkeit, der Fairness - ohne dem wird ein Land nicht dauerhaft prosperieren können. Ich glaube, dass es enorm gefährlich ist, wenn wir Situationen haben wie derzeit in Spanien, in Griechenland, wo wir Jugendarbeitslosigkeitsraten von 40 Prozent und ähnliches haben. Ich glaube, dass das auf Dauer einen Staat nicht stabilisieren kann und ich sehe umgekehrt genau die Möglichkeiten hier, dem auf der europäischen Ebene entgegenzuwirken. Ein Einzelstaat - das ist völlig richtig, was die Kollegin Tumpel-Gugerell gesagt hat -, aber letztlich sind doch die Möglichkeiten eines Einzelstaates vergleichsweise beschränkt. Ich glaube, wenn wir das durchsetzen wollen in einer Weltwirtschaft mit erheblicher Konkurrenz, ist die europäische Seite viel wichtiger. Ich bin ein vehementer Vertreter dessen, was man das europäische Sozialmodell nennt. Das heißt - wenn Sie wollen - ein aufgeklärter, ökonomisch funktionierender Wohlfahrtsstaat. Ich glaube nach wie vor, dass etwa das Modell, das wir in den skandinavischen Staaten haben, ein funktionsfähiges ist, ein dauerhaftes. Dass es vernünftig ist, für so etwas einzutreten, aber vernünftig heißt eben auch mit entsprechend solider Finanzierung. Wenn wir das erreichen: ein europäisches Modell mit solider Finanzierung, ist das schon etwas, was auch auf europäischer Ebene die Zustimmung zum europäischen Modell massiv erhöhen würde. Das sehe ich als eine Aufgabe, die man anstreben muss."
Hubert Christian Ehalt, Wiener Vorlesungen: "Herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, in Abwandlung der Wiener Lebensweisheit haben wir heute gehört, dass die Lage der Europäischen Union, die Lage des Euros alles andere als hoffnungslos ist. Man muss die Fragen aufnehmen und gestaltend wirken. Wir haben gehört: Bildung, Innovation, effiziente Leistung und Sparsamkeit in einem System, das auf den Sozialstaat und auf Solidarität nicht verzichten kann und nicht verzichten soll. Vielen Dank, dass Sie bei den Wiener Vorlesungen dabei gewesen sind. Kommen Sie wieder und schauen Sie das nächste Mal wieder zu, auf Wiedersehen."
Archiv-Video vom 01.08.2012:
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte (Termine, Kontaktmöglichkeiten,...) möglicherweise nicht mehr aktuell sind.
Wiener Vorlesung: "Staatsschulden - Wer ist schuld? Wer zahlt?"
Thema bei der Wiener Vorlesung am 19. März 2012 war die Staatsverschuldung. Bei Hubert Christian Ehalt zu Gast waren Gertrude Tumpel-Gugerell, Ewald Nowotny und Walter Ötsch. Wiener Vorlesungen - das Dialogforum der Stadt Wien
Länge: 58 Min. 01 Sek.
Produktionsdatum: 2012
Copyright: Stadt Wien/ORF III