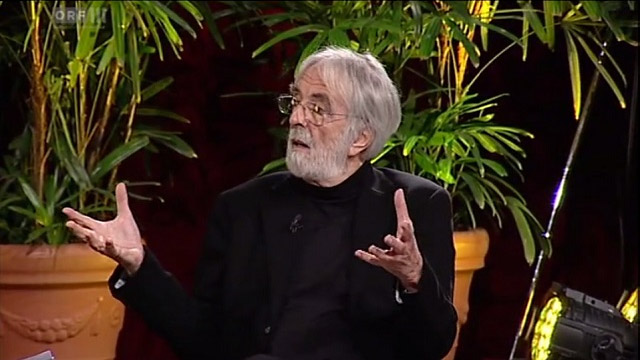Mitschrift
Meine Eltern mussten beide emigrieren, weil sie Juden waren als Hitler einmarschiert ist in Wien. Und unabhängig von einander – beide waren Kinder in der Zeit – unabhängig von einander haben sie es nach Israel geschafft. Meine Mutter legal, mein Vater illegal – eher abenteuerlich. Sie hatten sich in Wien schon gekannt, haben sich dann in Israel wieder getroffen, haben mit 18 geheiratet und zwei Jahre später, 1943, kam ich in Haifa, damals noch Palästina zur Welt.
Oskar Bronner mit C.
Palästina war damals ein britisches Mandat, also unter der Verwaltung der Briten. Daher war auch das Standesamt ein Britisches und daher hat der Standesbeamte den Namen, den mein Vater nach seinem verstorbenen Bruder Oskar ausgesucht hat – dieser Oskar hatte sich natürlich in Wien mit „k“ geschrieben – hat der dortige Standesbeamte automatisch den Namen mit „c“ geschrieben. Und so heiß’ ich immer noch: Oskar Bronner mit „c“.
Findung
Mein Vater hat 1938 bald gemerkt, dass er hier einfach keine Chance hat. Und sein Vater war im Konzentrationslager sehr schnell. Es wurde die Existenzbasis der Familie genommen und so ist er halt über die Grenze in die Slowakei gegangen – dort gab es Verwandte. Das war die erste Station. Aber auch das war nicht von langer Dauer und dann hat er sich über die Donau bis zum Schwarzen Meer durchgeschlagen. Klingt so einfach, aber das war verbunden unter anderem mit einer Situation, wo er über die Donau schwimmen musste, mit einem Freund zusammen. Und am anderen Ende des Ufers ist der Freund nicht mehr angekommen weil er unterwegs ertrunken ist. Mein Vater ja – mein Vater musste halt weiter.
Vater.
Mein Vater war ein Naturtalent was Musik betrifft. Er hatte ein absolutes Gehör, seine eigentliche Welt war die Musik. Und wann immer er gefragt wurde, was sein Beruf ist, hat er herumgedruckst, weil er so viele Dinge gemacht hat – von Lieder schreiben über übersetzen, Musicals übersetzen, aber auch Bücher übersetzen, Fernsehregie machen, Filmregie machen, Musik für Filme schreiben, Musik für’s Theater schreiben, Theater gründen und leiten und... Er hat dann immer herumgedruckst, was sein Beruf ist, aber wenn man ihn dann festgezurrt hat, blieb übrig: Musiker. Also das war sein – im Innersten – sein Beruf.
Hebräisch.
Ich bin vermutlich zweisprachig aufgewachsen, genau weiß ich’s nicht. Ich weiß nur, dass ich nur Hebräisch gesprochen habe. Und ich glaube, meine Eltern haben miteinander und mit mir Deutsch gesprochen. Auf die Art hab ich Deutsch verstanden aber nicht gesprochen. Und Kinder – also sobald ich in den Kindergarten kam – Kinder sind ja sehr, so dass sie sein wollen, wie alle anderen. Und da alle anderen Kinder Hebräisch gesprochen haben, wollte ich halt auch nur Hebräisch sprechen. Als... Ich war 5 als wir alle nach Wien übersiedelt sind und hier waren dann schon meine Großeltern. Also die väterlicherseits wurden umgebracht, die mütterlicherseits hatten in Shanghai überlebt und sind dann sobald wie möglich nach Wien zurückgekehrt. Und meine Großeltern haben mich nicht verstanden, weil die konnten kein Hebräisch. Ich sprach kein Deutsch und so haben sie meine Eltern gebeten, das Deutsch in mir ein bissl zu forcieren. Und das haben sie so erfolgreich gemacht, dass ich nach einem halben oder dreiviertel Jahr – haben sie dann mein Hebräisch an mir getestet und es war schlicht weg. Was mich weiter nicht gestört hat – also man kommt in Wien ohne Hebräisch sehr gut über die Runden. Ich war dann das erste Mal wieder in Israel im Jahr – als ich 17 Jahre alt war und war der Meinung, jetzt müsste ja doch irgendwo aus dem hintersten Winkel des Gehirns irgendwas zurück kommen – und es kam aber nix. Diese Sprache ist für mich ganz fremd, was seltsam ist, weil es muss ja irgendwo drinnen sein. Da ich auch nie Religionsunterricht hatte, hab’ ich auch da keinen Bezug bekommen: Also wenn Juden Religionsunterricht haben, müssen sie das Alphabet, also die Buchstaben lernen und dann kommt irgendein Bezug zu der Sprache. Aber ich bin vollkommen areligiös aufgewachsen. Und da hat mich dann eines Tages der Ehrgeiz gepackt und ich hab gesagt: Eigentlich sollte ich doch eine bissl eine Ahnung haben von meiner ersten Sprache – und hab’ in Wien einen Kurs besucht. An der Universität wurde das angeboten. Und ich habe wieder nicht so wahnsinnig intensiv gelernt weil ich doch wieder der Meinung war, irgendwann muss das doch aus dem Orkus herauskommen. Es ist nur nix heraus gekommen und irgendwann stellt der Lehrer eine Frage an mich. Und ich hab keine Ahnung und stottere herum und hinter mir – normale Schulsituation – hinter mir souffliert jemand und ich antwort’ halt irgendwie und dann dreh ich mich um, um mich zu bedanken: War das ein katholischer Pfarrer. Und ich fand diese Situation so seltsam, dass ein katholischer Pfarrer einem in Israel geborenen Menschen beim Hebräisch sprechen soufflieren muss, dass ich dann aufgegeben hab. Ich kann’s bis heute nicht und irgendwie funktioniert’s trotzdem.
Spielplatz.
Ich hab an meine Zeit in Israel kaum Erinnerungen. Das sind ganz wage Bilder. Möglicherweise mit dem Verlust der Sprache ist auch anderes verloren gegangen. Und meine ersten Erinnerungen gehen an die Zeit zurück, als ich mit 5 hierher gekommen bin: zum Beispiel das Erlebnis das erste Mal Schnee zu erfahren. Das gab’s für mich vorher nicht. In Israel gibt’s so was alle Jahrzehnte und also nicht zu der Zeit, als ich dort war. Und , also das war für mich eine interessante Erfahrung. Dann, wir reden jetzt vom Jahr 1948, Wien war sehr zerbombt. Wir haben im 1. Bezirk gewohnt, beim Passauer Platz. Da gab’s viele Ruinen, und die für uns Kinder wunderbare Spielplätze waren natürlich – lebensgefährlich. Ich bin froh, dass so was nicht mehr existiert hat, als meine Kinder in dem Alter waren, weil wir sind da durch vollkommen ausgebombte Häuser, die halt irgendwie, wo Traversen und so bis zum Dach noch standen, hoch geklettert und die Traversen entlang balanciert – für uns Kinder wunderbar, aber wahnsinnig natürlich. Man durfte auch nicht erwischt werden. Nicht erwischt werden durfte man zum Beispiel aber auch im Park. Der nächste Park bei uns war am Rudolfsplatz, wo jetzt Zäune stehen, damit Kinder ordentlich Ball spielen können. Man durfte in dem Park nicht Ball spielen – also der Effekt war, dass wir natürlich Ball gespielt haben und wann immer ein Polizist vorbeigekommen ist, hat er den Ball weggenommen.
Hamburg.
Als ich 10 wurde, kam ich dann ins Gymnasium, in meinem Fall ins Lycée Français, damit ich irgendeine andere Sprache wieder lernen kann. Und in dieser Zeit hat mein Vater aber dann ein Angebot bekommen nach Hamburg für das neu gegründete Fernsehen – damals gab’s in Österreich noch kein Fernsehen – sollte er dort Musik machen für, was es damals noch gab, Fernsehspiele uns sonstige Shows. Und so bin ich nach, ich glaub vier Monaten aus dieser Mittelschule wieder raus und nach Hamburg verfrachtet, musste dort wieder in die Volksschule weil Hamburg hat ein anderes Schulsystem, mit sechs - damals mit sechs Volksschulklassen.
Scheidung.
Mein Vater war dort nicht ganz allein. Es gab eine österreichische Kolonie, also unter anderem der Michael Kehlmann ist mit ihm mit, der Peter Wehle, der war auch dabei, der Helmut Qualtinger, glaub ich auch, aber nicht ständig, sondern bei gelegentlichen Produktionen. In Hamburg haben sich meine Eltern scheiden lassen. Beide haben sehr schnell wieder geheiratet, meine Mutter einen Herrn, der in Bonn gelebt hat und so sind wir alle – also so sind meine Mutter und ich von Hamburg dann nach Bonn übersiedelt. Diese Ehe hat nicht sehr lang gedauert, wir sind aber noch eine Weile geblieben bis ich 17 war und dann ist meine Mutter und ich wieder nach Wien zurück. Mein Vater ist schon vorher nach Wien zurück, 2 Jahre vorher oder so, weil auch seine Ehe hat nicht – seine neue Ehe – hat auch nicht sehr lang gehalten.
Beleuchter.
Nach der Scheidung war das halt eine normale Scheidungssituation, noch dazu eine, wo halt man in verschiedenen Städten lebt. Also ich hab meinen Vater primär bei Ferien, also in den Ferien gesehen. Gelegentlich hat er mich auch in Bonn besucht, vor allem dann... Er hat auch viel für Rundfunk gearbeitet und er war halt gelegentlich auch beim Westdeutschen Rundfunkt in Köln und so hat man das, so hab’ ich ihn doch einige, öfter sehen können. Dieser Kontakt wurde natürlich intensiver als wir dann alle wieder in Wien waren und ich hab’ dann... Da kam’s dann zu einer Situation als der Beleuchter in seinem Theater – er hatte dann das neue Theater am Kärntner Tor, wo die meisten der legendären Kabarettproduktionen mit Qualtinger aufgeführt worden sind – musste der Beleuchter ins Gefängnis, also musste eine Haft antreten. Und innerhalb von wenigen Tagen musste Ersatz gefunden werden. Und es wurde keiner gefunden und da ich die Produktion aber sehr gut gekannt habe, hab’ ich mich bereit erklärt, das zu machen. Und so wurde ich Beleuchter in dem Theater und blieb es auch eine ganze Weile. Dann kamen noch für die nächsten Produktionen, kamen dann noch Regieassistenz dazu. Also ich war so Beiwagerl in dem Theater und hab mich auch eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt überhaupt zum Theater zu gehen, also als Regisseur und – irgendwie so ein Traum – Theaterschreiber, also Stückeschreiber. Aber daraus ist – hab ich dann relativ bald die Lust verloren.
Kleinkunst.
Also meine Rolle in dem Theater war ja nur eine läppische, nämlich Beleuchter, Vorhangzieher, Regieassistent. Der Johann, der Sklenka, der leider nicht mehr sehr bekannt ist, oder nur in Insider-Kreisen, aber der ein sehr witziger Kerl war, hat dann irgendwann einmal bei einer Gelegenheit gesagt: „I wär mal sagen kenna, i hob no beim oiden Bronner g’arbeit“, weil sich’s so irgendwie dargestellt hat, als würd’ ich einmal in die Fußstapfen meines Vaters – zumindest beim Theater – eintreten. Was aber nie meine Absicht war. Aber ich hatte das Privileg, da Zeuge zu sein, wenn er eine enorm kreative Gruppe von Leuten, die da sicher die Nachkriegskultur Wiens mitgeprägt haben, auf einem Gebiet, dass aus mir nicht verständlichen Gründen immer „Kleinkunst“ genannt wird. Im Gegensatz zu was? Zur Großkunst? Das war, das ist Kunst. Das ist Kunst, das da entstanden ist und das Wort „Kleinkunst“ hab ich nie ganz verstanden. Es haben natürlich nicht alle das Gleiche gemacht. Es gab da gewisse Aufgabenteilungen, aber es gab natürlich auch Überschneidungen. Also die meisten oder sehr viele Sketches sind in der Kooperation zwischen Qualtinger und Merz erschienen, also die meisten Texte. Travnicek-Texte zum Beispiel waren alle von den beiden. Die Lieder wurden die meisten von meinem Vater geschrieben, also vom »Papa wird’s schon richten« in der allerersten Produktion noch »Brettl vor’m Kopf« im Jahr 1951 glaub ich, was ja dann eine Art Klassiker geworden ist. »Der Wilde mit seiner Maschin«, »Der Papa wird’s schon richten« – also all diese berühmten Qualtinger-Lieder, wo auch, wenn darüber geschrieben wird, gesagt: „Wie Qualtinger schon sagte: I waas zwoa ned, wo i hin fahr owa dafür bin i gschwinder dort“. Das ist auch dem Lied »Der Wilde mit seiner Maschin«. All diese Lieder waren sowohl Text und Musik von meinem Vater. Dann gab’s den – der März war auch noch meistens der Conférencier – also das war ganz altmodisch: Im Smoking ist der Conférencier und hat die verschiedenen Nummern eingeleitet, einkonferiert, wie der Name schon sagt. Er ist aber auch in manchen Sketches selber aufgetreten – aber selten. Der Peter Wehle war in dieser Kabarett-Gruppe, meiner Erinnerung nach, nicht oder wenig dabei. Der war mehr in Tandem mit meinem Vater, das war ein eingespieltes Team, die gemeinsame Shows hatten – sowohl im Theater, als auch im Fernsehen. Sie haben unendlich viele Lieder gemeinsam geschrieben, wo’s nicht auszumachen ist, wie viel Prozent von der Musik oder vom Text von dem einen oder vom anderen ist. Die haben so osmotisch miteinander gearbeitet, also da konnte einer den Satz des anderen beenden oder wenn ein Reim gefehlt hat oder ein Reim patschert war – also das war einfach fantastisch, wie eng diese beiden Herren zusammengearbeitet haben. Es war auch, also bei so kreativen Leuten ist es natürlich eingebaut, dass es immer wieder Krachs gibt. Und irgendwann zwischen meinem Vater und Qualtinger gab’s einen sehr langen Krach und die haben lang nix miteinander geredet. Zwischen Wehle und meinem Vater hat’s nie so was gegeben, da gab’s nie einen Krach. Die waren wie zwei Geschwister, also wirklich kongenial. Wehle, eher unterschätzt in dieser Partnerschaft – auch, die hatten die Aufgabenteilung, dass der Wehle immer der Blöde war und mein Vater der G’scheite. Das war in solchen Sketches eine klassische Aufgabenteilung und der Wehle ist dann gelegentlich angesprochen worden: „Sie sind doch doppelter Doktor. Wieso lassen Sie sich das gefallen, sich so von dem behandeln zu lassen?“ Also das war für manchen so glaubwürdig, diese Scheinstreits, die die da auf der Bühne hatten. Aber dahinter, im Persönlichen gab’s da nie einen Streit.
Vom Theater zum Journalismus.
Wie viele Menschen hab’ ich nicht gewusst, was ich einmal werden will. Obwohl ich einen Beruf hatte, nämlich ich war Beleuchter in einem Theater. Aber mir war klar, dass das nicht den Rest meines Lebens ausmachen soll. Aber irgendwie hab’ ich damit kokettiert überhaupt zum Theater zu gehen: Regisseur, vielleicht Stückeschreiber war so eine Idee. Und ich hab sogar, ich glaub ein Semester oder zwei Semester Theaterwissenschaft inskribiert, hab aber sehr bald gemerkt, dass dieses Studium mich überhaupt nicht interessiert und hab dann so herum hospitiert, hab auch ein bisschen Jus besucht. Warum, weiß ich nicht mehr. Und hab dann plötzlich die Eingebung gehabt, ich probier’s einmal mit dem Journalismus. Das ist ein großer Trichter, da lern’ ich einmal Schreiben, verlier’ diese berühmte Angst vor dem weißen Blatt weil Schreiben war schon ein Traum von mir. Also ich hab erwähnt, dass ich Stücke schreiben wollte, hab auch so ein paar Szenen geschrieben und so. Also, dachte ich mir, werd’ ich einmal das Schreiben in die Routine bekommen und vielleicht ist Journalismus etwas. Und der Zufall wollte es, dass irgendwann der damalige Chefredakteur der AZ bei meinem Vater zu Besuch war und der fragt mich, was ich denn nun werden will, weil Matura war gerade oder so. Und ich sag: „Journalismus vielleicht.“ Und dann sagt er: „Na ja, wollen Sie bei uns probieren, ob’s Ihnen gefällt?“ Und so kam dieses Angebot zustande und so da hab ich als Freelancer in der Lokalredaktion der Arbeiterzeitung über Verkehrsunfälle, Brände und Ähnliches berichtet. Und hab’ das Handwerk des Journalismus gelernt, bekam dann drei Monate später das Angebot in eine damals vorhandenen, existierende Zeitung namens »Express« zu übersiedeln, in die Innenpolitik. Das hat mich schon ein bisschen mehr interessiert als die Chronik-Redaktion. Und dort war ich dann, ich glaub eineinhalb Jahre oder so und bin dann übersiedelt zum Kurier, damals der berühmte Hugo-Portisch-Kurier, also unter Hugo Portisch. Und dort wollt ich aber nicht mehr Innenpolitik machen, sondern hab gebeten in die Wochenendbeilage zu gehen, weil ich einmal längere Geschichten schreiben wollte.
Fall Borodajkewycz.
Mein Studium hab ich mir mit diversen journalistischen Tätigkeiten finanziert. Ich hab für eine Vorläufersendung des »Reports«, damals hieß es »Horizont« beim Fernsehen gearbeitet. Ich hab’ im Radio Reportagen gemacht. Ich hab’ für meinen Vater gearbeitet, der eine Kabarettsendung namens »Zeitventil«, eine monatliche, glaub ich, namens »Zeitventil« gemacht hat. Da hab ich, so quasi, die Redaktion besorgt, also ich hab die Zeitungen danach durchgeschaut, nach Material, das die Ausgangsbasis für aktuelle Sketches sein könnte und hab dann zum Teil auch mitgeschrieben. In dieser Funktion wurde ich eines Tages angesprochen vom Heinz Fischer – heutiger Bundespräsident, damals Klub-Sekretär der SPÖ; wir waren befreundet – angesprochen, dass es da ein Protokoll gibt, eine Mitschrift von Aussprüchen, die ein damaliger Universitätsprofessor namens Taras Borodajkewycz von sich gegeben hat. Abenteuerliche antisemitische Aussprüche, abenteuerliche Nazi-mäßige Aussprüche, die der Mensch in seinen Vorlesungen von sich gegeben hat ohne dass irgendwem das gestört hat, außer einem jungen Studenten namens Lacina – der spätere Finanzminister – der das eben mitgeschrieben hat und dem Heinz Fischer gegeben hat. Ich glaub, es gab dann irgendwelche Veröffentlichungen in der Zukunft und es gab auch einen Prozess, aber irgendwie hat das Ganze zu nichts geführt. Und diese Mitschrift hat mir der Heinz Fischer irgendwann gegeben und hat gesagt: „Schau ob Du was damit machen kannst.“ Ich les’ das durch und das war wirklich beängstigend, zeig’ das meinem Vater und wir beschließen, daraus sollte man einen Sketch machen. Den Sketch, der war relativ einfach: Wir haben ein fiktives Interview mit einem Universitätsprofessor gemacht, der die Maske, dem Herrn Borodajkewycz dann sehr ähnlich sah. Wo ein Journalist ihm Fragen stellt und als Antwort kamen all diese Zitate, die da in diesem Protokoll standen. Und möglicherweise wäre das Ganze wieder verpufft, aber der Borodajkewycz war sich seiner Sache so sicher, dass er ein paar Tage später eine Pressekonferenz gibt, wo unter anderem auch Studenten von ihm dabei waren – im Publikum, neben den Journalisten – wo er diverse, dieser antisemitischen Dinge wieder weiter von sich gegeben hat mit dem höhnischen Lachen seiner Studenten, die halt seine Brut waren. Und da hat’s plötzlich geklickt und das man gesehen hat, was der anrichtet, nämlich mit jungen Menschen. Und daraus ist dann der Fall Borodajkewycz geworden. Es gab eine Riesen-Demonstration, mein Vater und ich sind da mitmarschiert, Kärntner Straße entlang hinunter. Parallel gab’s die Gegendemonstration der Borodajkewycz-Freunde. Wir haben geschrien: „Nazis raus!“ Die haben geschrien: „Juden raus!“ Also es wurde immer ungemütlicher: Vor der Oper gab’s dann einen Zwischenfall, wo – ich war nicht dabei – aber wo offensichtlich einer dieser Neo-Nazis einen ehemaligen Widerstandskämpfer und KZler niedergeschlagen hat, der daran gestorben ist. Kirchweger gilt zum Glück als – also der erste und zum Glück auch der einzige politische Tote seit dem Krieg.
Der Prozess.
Es kam dann zum Prozess gegen diesen jungen Herren, der ihn da niedergeprügelt, niedergeschlagen hat und es kam zu einer sehr, sehr niedrigen Verurteilung. Ich weiß es jetzt nicht mehr, 10 Monate bedingt oder irgendsowas – mit einer faszinierenden Begründung: Der Richter hat festgestellt, dass es eine Putativ-Notwehrüberschreitung vorlag. Falls man nicht gleich weiß, was das ist: Notwehr ist klar, Notwehrüberschreitung ist auch klar, dass man halt angegriffen wird und zu stark reagiert. Putativ-Notwehrüberschreitung ist, wenn man gar nicht angegriffen wird, aber glaubt angegriffen worden zu sein und dann zuschlägt und dann auch noch zu stark zuschlägt. Dieses Konstrukt wurde gebildet um diesen Totschläger ein niedriges Urteil angedeihen zu lassen. Und da hat bei mir irgendwas geklickt und ich hab begonnen mich dafür zu interessieren: Was sind Richter für Menschen und wo kommen die her und wer macht diese Karrieren? Wie wird jemand vom Richter zum Gerichtspräsidenten und im Obersten Gerichtshof und all das... Hab mich dafür zu interessieren begonnen und dabei herausgefunden, dass wichtige österreichische Richter, zum Teil im Obersten Gerichtshof, zum Teil aber dann in der Bürokratie – im Justizministerium, in der Personalabteilung – ehemalige Nazi-Richter waren. Und zwar solche, die Todesurteile gegen österreichische Widerstandskämpfer entweder erwirkt haben oder verhängt haben. Ich hab wochenlang in Dokumenten gegraben und dieses Material hab ich dann dem Friedrich Torberg gezeigt, der damals eine Zeitschrift namens »Forvm« herausgegeben hat und wir haben das im »Forvm« veröffentlicht. Das hat dann zu einem großen Zerwürfnis zwischen Torberg einerseits und Günther Nenning, der sein Chefredakteur war, auf der einen Seite und dem damaligen Justizminister Broda gekommen, weil Broda hat das weggewischt, also alle Angriffe gegen diese Richter – so quasi: „Die Republik hat den Schlussstrich gezogen. Das muss man akzeptieren“ – und ist überhaupt nicht auf die einzelnen Fälle eingegangen. Und so war’s halt.
Unabhängige Zeitung.
Ich hab gesehen, dass in Österreich ein Medium fehlt, dass unabhängig ist von allen Machtgruppen, das auf niemanden Rücksicht nehmen muss, wo man Zeit hat zu recherchieren, wo man dann auch längere Geschichten, also kompliziertere Zusammenhänge so präsentieren kann, dass es einen gewissen Impact hat. Und diese Zeitschrift sollte auch noch ein bisschen mehr Auflage haben, nämlich auch dadurch publizistische Kraft haben.
Vorbilder.
Und ich habe mir als Vorbild so quasi die Nachrichtenmagazine genommen – Time, Newsweek, Spiegel, L’Express – und wollte sowas für Österreich machen und hab relativ bald festgestellt, dass ich sowas nicht finanzieren kann. Und wenn ich mir eine Finanzierung hole, die das schafft, dann begeb’ ich mich in Abhängigkeit. Also da wäre dann ein gewisser Widerspruch gewesen und hab’ lange herum nachgedacht und festgestellt – beim Beobachten des Marktes, beim Analysieren des Marktes festgestellt, dass es in Österreich eine ganz starke Marktlücke gab, nämlich ein Wirtschaftsmagazin. Und dann war meine Überlegung: Ich gründ’ einmal das Wirtschaftsmagazin, schaff’ damit eine Infrastruktur mit einem Verlag, einer Anzeigenabteilung, einer Vertriebsabteilung und alles, was da so dazugehört. Das Wirtschaftsmagazin müsste um einiges billiger sein zu gründen und da könnte ich meine Unabhängigkeit behalten. Als Partner hab’ ich meinen Freund Karl Schwarzenberg gehabt, wir haben eine 50:50-Partnerschaft gemacht und bei dem hab’ ich gewußt, dass die Unabhängigkeit gewahrt ist. Außerdem war auch zwischen uns klar gestellt, dass ich allein für den redaktionellen Bereich zuständig war und – ich hab’ zwar nix von Wirtschaft verstanden und hab’ mich auch nicht wahnsinnig für Wirtschaftsjournalismus interessiert – aber ich hab’ das als Startrampe gesehen, um das »profil« gründen zu können – also später dieses Nachrichtenmagazin gründen zu können.
In der Vorbereitungszeit ist der Karl Schwarzenberg ausgestiegen aus dem Projekt, weil seine Berater ihm da massiv abgeraten, aber ich hab’ ihn gebeten formell dabei zu bleiben, weil es war schon angekündigt, dass er dabei ist und die Meldung, dass er aussteigt bevor die Nummer 1 erscheint, wär’ der Todeskuss für den Anfang gewesen. Also daher betrachte ich ihn heute noch als Gründungspartner. Und im September 1969 kam die Null-Nummer heraus und die hat ziemliche Furore gemacht. Und im Jänner 1970 kam die Nummer 1 heraus und das war von Anfang an ein ganz schneller Erfolg. Also meine Rechnung ist einigermaßen aufgegangen.
„Profil« Gründung.
Mit dem ziemlich schnellen Erfolg des »trend« konnte ich sehr bald die Gründung des »profil« angehen. Neun Monate nach der ersten Nummer des »trend« ist die erste Nummer des »profil«entstanden. »profil« war am Anfang auch ein Monatsmagazin. Es gab kein Vorbild und viele Vorbilder. Also es war: Wenn man eine Zeitschrift gründet, ist es nicht klug sich allzu sehr an irgendwelche Vorbilder anzuhängen. Eine Zeitschrift hat auch sehr viel mit Zeitgeist zu tun und es ist ein Unterschied, ob eine Zeitschrift in den 1940er-Jahren gegründet wird oder in den 1970er-Jahren. Also da schwingt auch der Zeitgeist dieser Zeit mit. Eine Zeitschrift wandelt sich zwar, aber es bleibt ein Teil des Spirits aus der Gründerzeit drinnen – so die Zeitung eine Seele hat.
Enthüllungs-Journalismus.
Eines der Elemente, das in Österreich gefehlt hat, war der investigative Journalismus – etwas, was es auf der ganzen Welt gibt, besonders in Amerika, besonders in Deutschland mit dem »Spiegel« – also das war, also dass der »Spiegel« irgendwelche Skandale aufgedeckt hat, war über lange Phasen fast wöchentlich der Fall. Für investigativen Journalismus braucht man Journalisten, die erstens das Talent dazu haben, zweitens denen man die Zeit geben kann und drittens eine Zeitschrift, die sich nicht erpressen lässt. Also man ist, wenn man Angst hat vor Anzeigenboykotten, dann soll man so eine Zeitschrift nicht machen, weil das unweigerlich kommt. Und das kam auch bei uns – also beim »profil«.
Erfolg.
Am Anfang hat ja niemand an das Projekt, an die beiden Projekte geglaubt – vor allem nicht meine Kollegen aus der Branche. Also die anderen Zeitungsverleger haben regelmäßig verkündet, dass das demnächst zu Ende sein wird, weil das kann sich nie ausgehen. Als das Ganze aber dann nach Erfolg ausgeschaut hat, haben sich auch dann noch andere Verlage für diesen Markt interessiert weil, es hat sich herausgestellt, das ist ein Markt. Ich mein, ich hab’ es nicht aus markttechnischen Gründen gemacht, sondern weil es mir ein Anliegen war, dass Österreich so eine Zeitschrift hat. Aber für kommerzielle Verleger ist das natürlich ein Markt, den, wo man nicht einsieht: Warum soll der den haben? Den haben wir lieber selber. Und die haben auch alle gewusst, dass niemand hinter mir stand. Also hat sich der Kurier mit der Gründung eines Wirtschaftsmagazins beschäftigt, hat einfachheitshalber fast meine komplette Wirtschaftsredaktion abengagiert. Die Kronen Zeitung hat sich mit der Gründung eines, nicht Nachrichtenmagazins, aber eines politisch-kulturellen Magazins beschäftigt, hat wieder einige Leute vom »profil« abengagiert – jeweils mit Verdoppelung der Gage. Also man kann’s kaum jemanden verdenken.
Übernahme.
Bei den anderen, also beim Kurier hat sich irgendwie die Meinung durchgesetzt: „Interessant, dass der das Ganze überlebt. If you can’t beat them, join them.“ Und plötzlich kam aus dem Kurier ein Angebot, dass man mir das abkaufen – den »trend« und »profil« – abkaufen will. Ich war entsprechend weichgeklopft und hab’ gesehen, also allein halt’ ich’s nicht durch. Irgendeinen Partner muss ich mir aufnehmen. Es gab dann Versuche mir einen Partner aus Deutschland zu vermitteln, aber die echte Unabhängigkeit, wo ich Alleineigentümer bin und wo niemand d’rein reden kann, das hab ich gewusst, die ist vorbei. Und es kam plötzlich dieses Angebot vom Kurier, in der Mafia-Literatur wird so was genannt „ein Angebot, das man nicht ablehnen kann“. Und ich hab dieses Angebot angenommen. Der Hintergedanke beim Kurier war, dass man auch mich bekommen, dazu bekommen wollte und eigentlich wollte man, dass ich den Kurier leiten soll.
Auszeit. Malerei.
Ich hab’ natürliche einen, selber einen Vertrag unterschrieben, dass ich bei »trend« und »profil« bleibe als Herausgeber, aber es gab sehr bald einen Artikel, mit dem die Eigentümer des Kurier – dahinter stand damals die Industriellenvereinigung – nicht sehr happy waren, weil ein Mitglied der Industriellenvereinigung kritisiert worden ist. Und das hat man mir vorgeworfen und darauf hin hab’ ich klar gestellt, dass ich nicht auf jedes Mitglied der Industriellenvereinigung Rücksicht nehmen kann bei jedem Artikel – und will. Und so ist man übereingekommen, es ist vielleicht klüger, man trennt sich und das fand dann nach wenigen Monaten statt. Und ich war ein freier Mensch und hatte das erste Mal in meinem Leben Geld auf dem Konto und hab’ mir gedacht, bevor ich jetzt das Geld in ein neues Projekt stecke, halt bis ich mit dem Geld eine neue Zeitschrift gründe oder was immer, leiste ich mir das, was zwei Träume von mir waren: Das eine war, ich wollte immer mal auf ein halbes Jahr nach New York fahren. Ich war irgendwann einmal in New York und war fasziniert von der Stadt und hab mir gedacht: „Hier möchte ich eine Weile leben.“ Und das zweite war, dass ich all die Zeit, während ich Journalismus und Sonstiges betrieben habe, immer daneben gemalt hab’. Und ich wollt’ mir – aber ich hab’s immer als Hobby betrachtet, kam nie auf die Idee, das zum Beruf zu machen, hab auch keine Akademie besucht. Aber es war immer eine Leidenschaft von mir. Und jetzt wollt’ ich einmal nix anderes machen als malen und selber ausloten, was ist da drinn’ in mir überhaupt. Weil es ist ein Unterschied, ob man am Sonntag schnell eine Zeichnung oder ein Bild macht oder ob man das konsequent als Recherche macht – und das wollte ich einmal ausloten. Und das hab’ ich mir geleistet. Und aus diesem halben Jahr in New York wurden 13 Jahre in New York und aus diesem Ausloten wurde eine kleine Karriere. Ich mein, ich konnte immerhin von meinen Bildern leben, was in New York nicht die Regel ist. Und nach 13 Jahren fand ich, jetzt ist es langsam Zeit wieder nach Wien zu kommen.
»New York Times« als Inspiration.
Als ich mich mit der Idee beschäftigt hab’, wieder in Wien zu leben, hab’ ich plötzlich registriert, dass ich 13 Jahre nicht nur in New York gelebt habe, sondern auch mit der »New York Times« und das ist halt eine der besten Zeitungen der Welt. Und die Tageszeitungen, die es damals in Wien gab, waren sehr schlecht und zum großen Teil nicht unabhängig oder Boulevard – also es waren schreckliche Zeitungen von der Qualität her. Und ich habe gesehen, mir wird die »New York Times« abgehen und so kam dann der Gedanke auf: Lässt sich das nicht ändern? Und da hab ich halt irgendwie den Markt einmal ein bisschen analysiert und bin zu dem Schluss gekommen, es müsste an sich Platz sein für so eine Zeitschrift. Und hab’ mich aber nicht damit... Ich wollt’ ja nicht zurück zum Zeitungsgeschäft, ich wollte weiter malen. Ich wollte malend wieder herkommen. Ich hab’ das irgendwann meinem Freund Fritz Molden, dem Urgestein der Nachkriegsverlegerschaft, erzählt und der hat dann gefunden, wenn ich der Meinung bin, dass es die Chance gibt für eine Qualitätszeitung in Wien, dann muss ich das einfach machen. Und er wird mir helfen.
Axel Springer Verlag. Der Standard.
Der Partner, der mir am Anfang, der mir bei den Verhandlungen und dann auch schließlich in den Verträgen, die aus den Verhandlungen heraus gekommen sind, die beste Garantie gegeben hat, dass ich eine unabhängige Zeitung machen konnte, war der Axel Springer Verlag. Es gab als sehr liberal bekannte andere Verlage, mit denen ich auch verhandelt habe, wo das nicht, wo diese redaktionelle Unabhängigkeit nicht in dieser Form mir garantiert wurde wie beim Springer Verlag.
Zeitungsgründung.
So eine Zeitungsgründung ist eine relativ teure Angelegenheit und sehr risikobehaftet und daher ist es auch sehr schwer Risikokapital aufzutreiben. Darum hab’ ich versucht, das Risiko ein bisschen zu minimieren, indem ich... Es hat eine gewisse Analogie zur Gründung von »trend«, obwohl ich eigentlich das »profil« gründen wollte. Ich hab einfach auch hier, auch damals das Risiko minimiert. Es gab diverse Zeitungen in Österreich, die, meiner Meinung nach, alle schlecht waren. Aber sie waren nun mal da und haben eine gewisse Marktpräsenz gehabt – und Leute wechseln so leicht nicht die Zeitung. Darum wollte ich, hab ich ganz bewusst keine General-Interest-Zeitung gegründet, also keine Vollzeitung, sondern eine Zeitung – wie wir im Untertitel damals geschrieben haben – für Wirtschaft, Politik und Kultur, Schwerpunkt Wirtschaft. Das war, hatte mehrere Vorteile auf einmal: Erstens ist die Gründung einer Zielgruppen-Zeitung preisgünstiger als die einer Vollzeitung. Ich spar’ mir ganze Teile von der Redaktion, ich spar’ mir Umfänge. Es hat aber auch den großen anderen Vorteil, dass ich keine unmittelbare Konkurrenz für eine vorhandene Zeitung bin. Also jemand der bis dahin irgendeine Zeitung gelesen hat – und ich hab mich ja primär an vorhandene Zeitungsleser gewandt – konnte diese Zeitung daneben kaufen, dazu kaufen, weil er halt an Wirtschaft, speziell an Wirtschaft interessiert war. Und ich bin damit die Frontalkonkurrenz, war ich der Meinung, das wir ausweichen und auf die Art wollte ich langsam Auflage aufbauen. Ich bin ausgegangen davon dass ich am Anfang 10.000 Stück verkaufen werde und in fünf Jahren ungefähr 30.000 Stück. Und dann war das mit meinem Partner Springer ausgemacht, wenn wir 30.000 Stück erreichen, schalten wir um zur Vollzeitung, weil dann kann man sich das leisten. So war die Kalkulation. Wir sind herausgekommen und haben sensationell verkauft. Das ist üblich, dass man am Anfang viel verkauft, dann sinkt’s ein bisschen und dann ist die Frage: Wo ist die Talsohle? Und dann muss es wieder rauf gehen. Wenn’s dann nicht wieder rauf geht, ist es ein Flop. Also im Englischen spricht man dann vom „Jockey-Stick-Chart“, das heißt also es geht so runter und dann wieder hinauf. Und so war’s auch bei uns: Es ging, es war am Anfang, die Auflage am ersten Tag, die ersten paar Tage waren wir ausverkauft und dann ging’s langsam hinunter. Und dieses Tal war so, dass wir nie unter, glaub ich, 37.000 Stück verkauft haben. Also der Erfolg war für uns unvorstellbar. Noch einmal: Wir sind davon ausgegangen, dass wir nur 10.000 Stück verkaufen werden am Anfang und dann langsam aufbauen.
Probleme.
Das Verhältnis zwischen Axel Springer Verlag und mir war natürlich auch überschattet, dass es wirtschaftlich mühsamer war, als es hätte sein sollen. Es lag zum Teil daran, dass der Springer Verlag zwar den Mut hatte, Geld für so ein Projekt zur Verfügung zu stellen, aber dann nicht die besten Leute dafür abgestellt hat um das zu betreiben. Und dass die großen Wert darauf gelegt haben, dass Leute aus Deutschland hier sitzen müssen, die den österreichischen Markt überhaupt nicht kannten. Und jeder Markt ist anders. Und es gibt Netzwerke. Und es gibt Seilschaften. Und man muss die Leute kennen. Und darauf haben die überhaupt keine Rücksicht genommen. Die Manager, die hierher geschickt wurden, sind, haben Null Kontakt mit der Werbebranche hier gehabt.
Rückkauf.
Und in den sechseinhalb Jahren der Partnerschaft zwischen Springer und mir hatte ich’ s mit vier verschiedenen Vorstandsvorsitzenden zu tun und mit fünf verschiedenen Vorstandsmitgliedern, die für mich, also für dieses Projekt zuständig waren. Wer je mit großen Konzernen gearbeitet hat, der weiß, dass jeder neue Vorstandsmacher, einmal alles in Frage stellt, was vor ihm entschieden worden ist und was immer der Vorgänger gesagt hat, war ein Blödsinn und „ich weiß genau wo’s lang geht“. Und bei diesem Hü-Hott der jeweiligen Manager, die da nach Wien gekommen sind, einigermaßen geraden Kurs zu halten, war für mich nicht ganz leicht und hat mir keine Freunde gemacht, weil sehr bald hatte ich den Ruf „mit dem kann man nicht arbeiten, der will nichts einsehen“. Was man wahrscheinlich akzeptiert – möglicherweise akzeptiert hätte – wenn das Ganze ein Riesenerfolg gewesen wäre, aber, wie geschildert, ging’s halt langsamer als geplant. Ich hab aber immer noch an das Projekt geglaubt, weil gewisse Kennzahlen haben gestimmt – zum Beispiel bei den Lesern. Wir hatten von Anfang an mehr Leser als geplant und das ist auch angewachsen. Und mir war klar, dass wenn so viele Leser dieser Qualität, zu dieser Zeitung greifen, dass irgendwann auch die Werbung dazukommen wird. Aber Springer hat dann letztendlich nicht mehr an das Projekt geglaubt. Es kamen dann Angebote von Kurier, den Standard da hinein zu fusionieren und den wollte Springer annehmen. Ich hab’ mich quer gelegt, ich hatte ja 50 % der Stimmrechte. Und so kam dann wieder ein neuer Vorstandsvorsitzender in Hamburg und der wollte mit mir kurzen Prozess machen und hat gesagt: „Entweder wir übergeben das jetzt dem Kurier, aber Sie werden sich da sicher quer legen. Daher geben wir Ihnen jetzt ein Monat Zeit und Sie können die Anteile kaufen.“ Also das war ganz klar, dass ich nie das Geld aufstellen werden, um die Anteile zu kaufen. Und so hat man dieses Angebot mir gemacht. Ich hab’ aber dann einen Bankkredit – das Geld mit Ach und Krach zusammengekratzt und konnte die Anteile damit kaufen.
Heimatstadt Wien.
Ja, ich hab in einigen Städten gelebt. Wien ist meine Heimatstadt: Hier bin ich geformt worden. Hier kenn’ ich die, wenn jemand spricht, verstehe ich die Obertöne, die da mitschwingen. Wenn jemand mich anlügt, hör’ ich’s da eher als wo anders. Es gibt faszinierendere Städte: New York, wo ich lang gelebt habe, Paris, London. Aber dort wo man zu Hause ist, dort wo man Heimatgefühl empfindet, das ist etwas, was man schwer eintauschen kann und will. Über Zeit – um auch den Kontrast zu spüren und ich hab’s ja genossen, möcht ich dazu sagen – aber irgendwann hat sich das Gefühl eingestellt, jetzt möcht’ ich wieder nach Hause.
Archiv-Video vom 11.08.2014:
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte (Termine, Kontaktmöglichkeiten,...) möglicherweise nicht mehr aktuell sind.
Oscar Bronner (Herausgeber)
Wir und Wien - Erinnerungen Oscar Bronner wurde am 14. Jänner 1943 in Haifa als erster Sohn des späteren Kabarettisten Gerhard Bronner geboren, der 1938 nach dem Anschluss Österreichs als Jugendlicher allein nach Palästina geflüchtet war. Seine ersten journalistischen Erfahrungen sammelte er als Freelancer bei der "Arbeiter-Zeitung", beim "Boulevard-Express" und bei der Tageszeitung "Kurier", ehe er 1970 das Wirtschaftsmagazin "trend" und das Nachrichtenmagazin "profil" gründete. 1988 gründete er die Tageszeitung "Der Standard", deren Verleger und Herausgeber er ist.
Länge: 56 Min. 25 Sek.
Produktionsdatum: 2013
Copyright: Stadt Wien