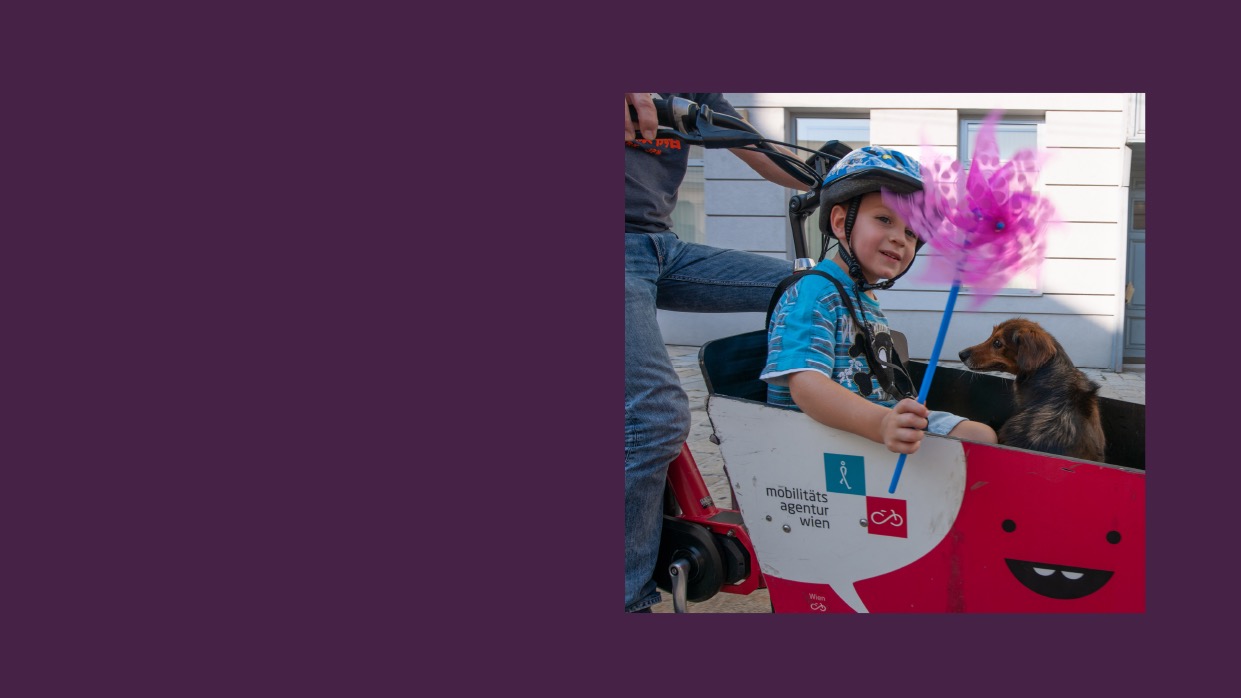
7.1 Raunz nicht, sei bruttoglücklich!

Regelmäßig landet Wien in den Ranglisten der lebenswertesten Städte der Welt ganz oben. Die Stadtplanung verlässt sich aber nicht nur auf die Bewertungen von außen, sondern koordiniert selbst seit einem Vierteljahrhundert umfassende Studien zur Lebensqualität der Wiener Bevölkerung.
Franziska Leeb
Was werden uns nicht tagtäglich für Mittelchen und Dienstleistungen zur Verbesserung der Lebensqualität angetragen: Heil- und Lebensmittel, Therapien, Ratgeber in Buchform und Gesundheits-Apps ebenso wie Sportgeräte, Klimaanlagen und elektronische Gadgets. So jung die Popularität des Begriffs Lebensqualität und die Methoden seiner Messung sind, so inflationär ist gefühlt seit Anbruch der 2010er-Jahre seine auf allen Kanälen zelebrierte Verwendung. Aber was ist Lebensqualität? Wie objektiv ist sie messbar? Und warum belegt Wien in den zahlreichen Rankings der Städte mit der höchsten Lebensqualität regelmäßig Sieger- und Spitzenplätze?
Dass wirtschaftliche Kennzahlen nicht alles sind, um das Wohlergehen einer Bevölkerung beurteilen zu können, ist keine neue Erkenntnis. „Wenn die Regierung kein Glück für das Volk schaffen kann, dann gibt es keinen Grund für die Existenz der Regierung“, hieß es bereits 1729 in einem bhutanesischen Rechtskodex. Jigme Singye Wangchuck, vierter König Bhutans, prägte 1979 den Begriff „Bruttonationalglück“. Es spiegelt sich in vier Säulen wider, die 1998 definiert wurden – in einer sozial gerechten Gesellschafts- und Wirtschaftsentwicklung, in der Bewahrung und Förderung kultureller Werte, im Schutz der Umwelt sowie in guten Regierungs- und Verwaltungsstrukturen.
Bereits seit 1995 werden regelmäßig die Wiener Lebensqualitätsstudien durchgeführt, bei denen die Bevölkerung zu Bereichen wie Wohnen, Arbeit, Familie, Gesundheit, Kultur, Freizeit oder der Zufriedenheit mit öffentlichen Angeboten befragt werden. Denn Lebensqualität lässt sich nicht ausschließlich mit objektiven Kennwerten messen. Sie hängt auch vom subjektiven Empfinden der Menschen ab. Jenes der Wiener Bürgerinnen und Bürger ist weitgehend positiv.
Eine Frage des Lebensstils

Für die jüngste Studie, in die neue Themen Eingang fanden, wurden 2018 mit 8.450 Personen ab dem 15. Lebensjahr umfassende Interviews geführt. Die Zufriedenheit mit dem Wohnumfeld, den Bildungseinrichtungen, den Kultur- und Freizeitangeboten, dem Gesundheitswesen und den Arbeitsbedingungen wird ebenso unter die Lupe genommen wie die Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Erstmals wurden auch Internetnutzung, Digitalisierung, Lebensstiltypologie und Bewertung des Stadtwachstums abgefragt.
Die Ergebnisse sind gelegentlich überraschend. So stehen Personen, die 60 Jahre und älter sind, dem Wachstum am positivsten gegenüber, während dieses bei den 45- bis 59-Jährigen am wenigsten gut bewertet wird. Je höher der Bildungsgrad der Befragten, umso mehr Zustimmung findet das wachsende Wien – am meisten übrigens von Personen, die im Ausland geboren sind. Bemerkenswert ist auch, dass sowohl die öffentliche Sicherheit (zu 70 Prozent) als auch die subjektiv wahrgenommene Sicherheit (zu 73 Prozent) hoch eingeschätzt werden. Das sind – selbst wenn die Berichterstattung der Boulevardmedien das Gegenteil vermuten ließe – höhere Werte als in den Jahren zuvor, die zugleich die Fakten der Kriminalstatistik bestätigen.
Abgefragt werden auch die Möglichkeiten gesellschaftlicher und politischer Partizipation wie zum Beispiel durch Gemeinschaftsaktivitäten im nachbarschaftlichen Umfeld, in Vereinen, bei Bürgerbeteiligungsangeboten der Stadt Wien, in Bürgerinitiativen oder etwa in politischen Organisationen. Migrantinnen und Migranten der zweiten Generation geben übrigens doppelt so oft an, sich zu beteiligen, wie Personen ohne Migrationshintergrund oder Zugewanderte der ersten Generation.
35 Quadratmeter Glück pro Kopf
Stark hängt die Zufriedenheit der Menschen vom jeweiligen Wohngebiet ab. Auf Basis der Wiener Lebensqualitätsstudien werden daher auch kleinräumige Unterschiede zwischen insgesamt 91 Bezirksteilen herausgearbeitet. Dabei zeigte sich, dass nicht alle Faktoren eines Wohnumfeldes gleichermaßen mit dem Grad der Zufriedenheit korrelieren. Eine schlechte Anbindung an den öffentlichen Verkehr wird in Randbezirken wettgemacht durch gute Luft und Grünanlagen vor der Haustür. In Innenbezirken ist es genau umgekehrt.

Der Wiener Wohnbau genießt einen exzellenten Ruf über die Landesgrenzen hinaus. Aber sehen das die Wiener und Wienerinnen, die damit aus erster Hand vertraut sind, auch so? Haben steigende Mieten und knapper Wohnraum die Unzufriedenheit erhöht? Von Mangel an Wohnraum sind laut Studie elf Prozent der Menschen in Wien betroffen, also zwei Prozent mehr als 2013. 1995 waren es aber noch 26 Prozent. Alleinerziehende und Paare mit Kindern unter 15 Jahren sind davon besonders betroffen. Mit rund 35 Quadratmetern ist die durchschnittliche Wohnnutzfläche pro Person sehr hoch. Zu Beginn der 1960er-Jahre waren es noch 22 Quadratmeter.
Geht man weiter zurück, an den Beginn des 20. Jahrhunderts, und vergegenwärtigt sich, dass damals bei einer Einwohnerzahl von über zwei Millionen rund 300.000 Menschen keine Wohnung hatten, 1934 jede zehnte Wienerin und jeder zehnte Wiener in einem Gemeindebau wohnten und dies derzeit auf ein Viertel zutrifft, wird klar, welch großen Einfluss die steuernde Hand der städtischen Verwaltung auf die Wohnversorgung hat. Recht anschaulich lässt sich die Großzügigkeit der Wiener Wohnverhältnisse auch mit einem Blick auf die Wohnungsstatistik darstellen. Im Bezirk Margareten lebten um 1900 rund 107.000 Einwohner in 25.300 Wohnungen. Heute sind es 54.246 Menschen in 33.081 Wohnungen. Der Unterschied ist frappant.
Und so nimmt es nicht wunder, dass 77 Prozent der Befragten mit ihrer Wohnsituation zufrieden sind. Über einen Lift verfügen übrigens 71 Prozent der Wohnhäuser, 65 Prozent haben einen Fahrradabstellraum und 44 Prozent begehbare Grünflächen. Umgekehrt sind ebendies die Einrichtungen, die sich jene, die sie nicht haben, wünschen, während ein Kinderspielplatz im Hof oder Kinderwagenabstellräume seltener vermisst werden.
Mit dem Kinderwagen durch die Stadt
Nicht nur der Komfort in den eigenen vier Wänden hat sich eklatant verbessert. Auch im öffentlichen Raum lässt es sich besser leben, sofern dem unmotorisierten Menschen nicht sein motorisierter Kompagnon den Platz streitig macht. Es hat sich viel getan, seitdem 1974 der Verkehr aus der Kärntner Straße verbannt und die erste Fußgängerzone der Stadt geboren wurde. 2020 wird die hundertste eingerichtet werden, immerhin!
War noch vor 20 Jahren ein Ausflug mit dem Kinderwagen ein Hürdenlauf über hohe Gehsteigkanten und ebensolche Einstiege in Straßenbahnen und Busse, so lässt sich heute das Leben mit Kleinkind in der Großstadt weitaus einfacher bewerkstelligen. Erst ab den 1990er-Jahren fanden Barrierefreiheit und inklusives Design sukzessive Eingang in die Baugesetzgebung sowie in diverse Planungsinstrumentarien. Zahlreiche kleine Maßnahmen erhöhen die Nutzbarkeit des öffentlichen Raumes. Oft nimmt man abgeflachte Gehsteigkanten, taktile Bodenleit- und Akustiksysteme an Ampeln erst dann wahr, wenn die eigene Mobilität eingeschränkt ist.
Barrierefreiheit ist auch ein Thema bei digitalen Angeboten. Nicht alle sind leicht zu bedienen. Fast drei Stunden pro Tag nutzen die Befragten das Internet für private Zwecke – Männer 40 Minuten länger als Frauen. Besonders für Einkäufe, für die Teilnahme an sozialen Netzwerken und für Kontakte zu öffentlichen Stellen ist die Akzeptanz hoch. Dennoch wollen 59 Prozent über das Internet nicht mehr erledigen oder organisieren, als sie dies heute schon tun. Noch mehr Internet ist nicht gleichbedeutend mit noch mehr Lebensqualität, könnte man daraus schließen.
Das Online-Angebot der Stadtverwaltung bewerten 36 Prozent für sehr gut – doppelt so viele wie fünf Jahre zuvor. Gut finden es 40 Prozent. Ob diese verbesserten digitalen Services auch Einfluss haben auf die gestiegene positive Beurteilung der Bürger- und Bürgerinnen-Nähe sowie der Stadtverwaltung insgesamt? Zu über zwei Drittel ist die Bevölkerung mit der städtischen Verwaltung und den Behörden zufrieden. Das sind immerhin doppelt so viele wie beispielsweise in Berlin.

Sag’s Wien mit einem Klick!
Der Glascontainer geht über? Der Gackerlsackerl-Spender ist leer? Die eine Straßenlaterne leuchtet zu hell und die andere gar nicht? Eine Fahrradleiche blockiert den Radständer? Schon wieder ein E-Scooter am Gehsteig? Ein wackeliger Kanaldeckel? Ein zu tief hängendes Verkehrsschild? Bereits 50.000-mal wurde die 2017 eingerichtete Bürger-Service-App Sag’s Wien heruntergeladen. Wozu es früher Überwindung und Zeit brauchte, reichen jetzt ein paar Klicks, um Meldungen über Unzulänglichkeiten im öffentlichen Raum unkompliziert an die Stadtverwaltung zu senden. Diese antwortet rasch und informiert laufend mittels Push-Benachrichtigung über den Status der Bearbeitung. Auch das trägt dazu bei, dass sich die Menschen in ihren Anliegen ernstgenommen fühlen und spüren, dass die Verwaltung rasch reagiert.
Das Raunzen gehört angeblich zum guten Ton. Trotzdem leben 90 Prozent der Wienerinnen und Wiener recht zufrieden in ihrer Stadt, die Älteren übrigens am allerliebsten. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass es ausreichend Gelegenheiten gibt, seinen Grant loszuwerden – für die Digitalaffinen die App, für die anderen das mobile Beschwerdeklo, wo man sein Geraunze auf Tonband hinterlassen kann. Seelenhygiene auf Wienerisch.
Gut tut es der Wiener Seele auch, seit Jahren die Schlagzeilen über die lebenswerteste Stadt der Welt zu lesen. In den zahlreichen internationalen Städte-Rankings belegt Wien durchwegs Spitzenpositionen. Zum zehnten Mal in Folge bewertete die Beratungsfirma Mercer unter insgesamt 231 Großstädten Wien 2019 als lebenswerteste Stadt. Bewertet werden beim Quality of Living Survey harte Fakten. Zu den untersuchten 39 Kriterien zählen politische, soziale, wirtschaftliche sowie Umweltfaktoren, die von unabhängigen Instituten und Behörden erhoben werden.
Zu zwei Prozent fließt die Meinung von Expatriates – Menschen, die zum Arbeiten nach Wien kommen – und damit also auch der subjektive Blick von außen ein. Für die hervorragende öffentliche Daseinsvorsorge in Wien, für den Wohnungsmarkt, für die Verfügbarkeit von Konsumgütern, für die niedrige Kriminalität und für die politische Stabilität erhält Wien höchste Punktezahlen, während Klima und Straßenverkehr mittelmäßig abschneiden. Auch bei der Luftverschmutzung sieht die Studie Verbesserungsbedarf. All das sind Faktoren, die nicht nur für temporär in Wien lebende Managerinnen und Manager relevant sind, sondern auch für die Gesamtbevölkerung. Die Kritik, dass der Wiener Flughafen nur wenige internationale Direktverbindungen bietet, wird die Durchschnittsbevölkerung im Alltag weniger tangieren.
Ein Index für 1,9 Millionen Wiener Gehirne
In der Mercer-Studie folgt Zürich auf dem zweiten Platz. München, Auckland und Vancouver belegen gemeinsam Platz 3. Die Reihe der Ranglisten der besten Städte ist lang und deren Bewertungsraster und Schwerpunkte unterschiedlich. Bemerkenswert ist es daher durchaus, dass Wien auch in anderen repräsentativen Studien an die Spitze gesetzt wurde. Beispielsweise beim Global Liveability Index der renommierten Zeitschrift The Economist, bei dem Wien 2019 zum zweiten Mal vor Melbourne und Sydney an der Spitze von insgesamt 140 untersuchten Städten stand.
Den ersten Platz vor London im Smart City Index 2019, für den Roland Berger weltweit die Smart-City-Konzepte von 153 Städten unter die Lupe nahm, verdankt Wien seiner Umsetzungskompetenz. Denn Wien kann nicht nur mit vernetzten Lösungen für Mobilität und Umwelt, mit einem fortschrittlichen E-Health-Ansatz und mit offenen Verwaltungsdaten aufwarten, sondern hat auch eine standardisierte Fortschrittskontrolle für alle Smart-City-Projekte eingeführt. Die Smart City Agency bündelt technische Kompetenzen und koordiniert zudem die verschiedenen Interessen.
Eine dichte Datenlage ist eine gute Grundlage für die Stadtplanung und verhindert, dass die Entwicklung der Lebensqualität von zu vielen unplanbaren Zufälligkeiten abhängt. Datentransparenz trägt dazu bei, das kollektive Know-how zu erhöhen und möglichst viele der 1,8 Millionen Wiener Gehirne zu nutzen. Zahlen, Daten, Fakten und ihre sinnvolle Anwendung helfen, die Lebensqualität auf hohem Niveau zu halten und weiter zu steigern. Wer weiß: Vielleicht lässt das Wiener Bruttokommunalglück irgendwann alle Raunzerzonen obsolet werden?
