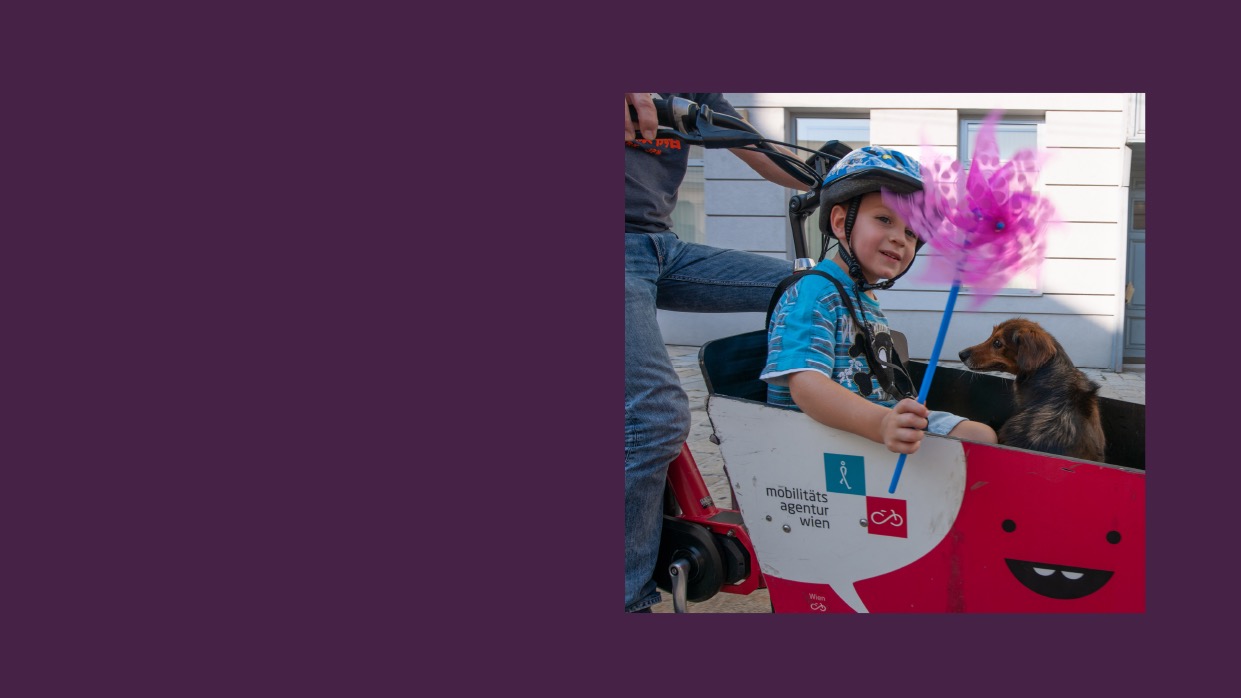
7.6 „Irgendwer regt sich immer auf, und das ist auch gut so“
Wojciech Czaja im Gespräch mit Bernhard Görg

Wie misst man städtische Zufriedenheit? Welchen Anteil daran trägt die emanzipierte Partizipationsgesellschaft? Und welche Werkzeuge hat die Stadtplanung, um die urbane Lebensqualität mitzugestalten? Der ehemalige Planungsstadtrat Bernhard Görg über Stufen, Schlitzohren und die viel zu lauten Schafberg-Glocken.
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben?
Görg: Zufriedenheit war für mich nie eine erstrebenswerte Kategorie. Ich habe nie danach getrachtet, zufrieden zu sein, denn das hätte bedeutet, einen Zustand erreicht zu haben, in dem ich verweilen möchte. Ich halte es lieber mit den Stufen von Hermann Hesse und denke schon an die dritte Stufe, sobald ich die zweite erreicht habe.
Dann frage ich Sie anders: Sind Sie glücklich?
Görg: Ja, ich war und bin mit meinem Leben ziemlich glücklich. Glück ist eine durchaus erstrebenswerte Kategorie! Und ich muss zugeben: Ich hatte in meinem Leben viel Glück, sehr viel Glück sogar – wenngleich ich nicht alles erreicht habe, was ich mir auf den unteren Stufen so vorgenommen hatte.
Was haben Sie denn nicht erreicht?
Görg: Meine politische Karriere – um nur ein Beispiel zu nennen – ist sicherlich nicht so gelungen, wie ich mir das gewünscht hätte. Man kann nicht alles haben.
Was sind denn Kriterien für Glück und Zufriedenheit in einer Stadt?
Görg: Ich unterscheide zwischen objektiven und subjektiven Faktoren. Zur subjektiven Lebensqualität gehören beispielsweise Wohnung, Einkommen, Gesundheit, familiäre Situation und soziale Bindungen. Diese Qualität kann man als Politiker nicht wirklich beeinflussen. Und dann gibt es die objektive Lebensqualität, zu der ich Wohnungsangebot, Leistbarkeit, Arbeitsplätze, Verkehrsinfrastruktur, Grün- und Freiraumqualität, medizinische Versorgung, Bildungsangebot und die kulturelle Vielfalt einer Stadt dazuzählen würde. All diese Faktoren kann die Politik bis zu einem gewissen Grad mitgestalten.
Im Mercer-Ranking belegt Wien schon seit vielen Jahren den Platz 1. Wie repräsentativ sind denn die Mercer-Kriterien, um die Lebensbedingungen einer Stadt zu messen?
Görg: Das hängt immer davon ab, ob Sie in der Regierung oder in der Opposition sind.
Suchen Sie sich eine Position aus!
Görg: Ich nehme gerne die neutrale Mitte ein, obwohl mein Herz in Wien derzeit gezwungenermaßen in der Opposition schlägt. Wie wir ja wissen, orientiert sich die Mercer-Bewertung vor allem am Potenzial und an der Alltagsqualität eines Standortes für Expats und Arbeitstätige. Das deckt sich nicht unbedingt zu 100 Prozent mit den Kriterien für Wienerinnen und Wiener. Dennoch darf man mit Fug und Recht sagen, dass Wien eine extrem hohe Lebensqualität hat und dass die Bewohnerinnen und Bewohner mit dieser Stadt überdurchschnittlich zufrieden sind.
Sie haben die politische Planbarkeit von Lebenszufriedenheit angesprochen. Welchen Stellenwert in der Lebensqualität einer Stadt nimmt denn das zivile Engagement ein?
Görg: Einen sehr großen! Ich kann mich erinnern, dass Bürgermeister Helmut Zilk, als er in der Stadt spazieren war und irgendwo einen überfüllten oder umgekippten Mistkübel gesehen hat, sofort in die nächste Trafik gegangen ist und die MA 48 angerufen hat: „Ihr kommt’s jetzt sofort her und räumt’s den Colonia-Kübel auf!“ Das ist in gewisser Weise ziviles Engagement, denn als Politik kann man so eine Situation nicht bezeichnen. Aber ja, solche Impulse sind extrem wichtig. Auch wenn nur die wenigsten Menschen Bürgermeister sind, so können doch wir alle die Stadt mitgestalten. Am Land äußert sich dieses Zivilengagement in Vereinen, Blasmusikkapellen und in der Freiwilligen Feuerwehr. In der Stadt müssen dafür andere Formate gefunden werden.
Und zwar?
Görg: Das Städtische muss in kleinere Portionen aufgeteilt werden – in Gebietsbetreuungen, Grätzelinitiativen und Straßenfestln. Zu meiner Amtszeit als Planungsstadtrat wurden diese zivilen, individuellen Aktivitäten auf Quartiersebene meiner Einschätzung nach zu wenig gefördert, aber in den letzten Jahren beobachte ich hier eine deutliche Zunahme von Impulsen und Initiativen.

Können Sie uns ein Beispiel aus Ihrem Blickwinkel als Hernalser nennen?
Görg: Oh ja! Da gibt es die Kirche am Schafberg, die ein fast mikroskopisches Mini-Dasein fristet. Der Dornbacher Pfarrer hat sich sehr darum bemüht, in dieser Schafbergkirche eine kleine Gemeinde aufzubauen, was ihm allerdings nicht gelungen ist. Nachdem die Schafberg-Glocken aber einen so wunderschönen Klang haben, hatte er schließlich die Idee, diese Glocken in die Dornbacher Kirche – ein Clemens-Holzmeister-Bau, wohlgemerkt – zu transferieren. Sie können sich nicht vorstellen, was für einen Mordsaufschrei das gegeben hat! „Wie können die nur! Eine Frechheit ist das!“ Die Menschen waren regelrecht brüskiert. Das nenne ich Zivilengagement – obwohl es freilich lohnendere Themen gegeben hätte.
Wie ging die Geschichte aus?
Görg: Der Pfarrer hat sich durchgesetzt und hat die Glocken aus der Schafbergkirche in die Dornbacher Kirche bringen lassen. Besonders lustig wird die Anekdote dadurch, dass die Schafberg-Glocken so laut sind, dass sie für die Dornbacher Bevölkerung nun gedämpft werden mussten.
Von 1996 bis 2001 waren Sie amtsführender Stadtrat für Planung und Zukunft. Kann man Zukunft denn überhaupt planen?
Görg: Ja, Zukunft kann man planen – allerdings mit dem Wissen, dass man mit der Planung und Prognose manchmal komplett danebenliegt. Zu meiner Zeit bei IBM haben wir jahrelang vorhergesagt, dass der Personal-Computer, der sogenannte PC, niemals ein Geschäft werden wird! Auch in der Politik wird die Zukunft manchmal völlig falsch geplant, denn manche Entwicklungen und Ereignisse kann man nun wirklich unmöglich vorhersagen ...
Aber?
Görg: Aber, wenn die Zukunftsplanung halbwegs gut ist, dann stellt sie sich in weit über 50 Prozent als richtig und wahr heraus. Immerhin! Außerdem darf man nicht vergessen, dass Zukunftsplanung nicht zuletzt auch eine wertvolle Zukunftsvorbereitung ist. Aber ich gebe zu bedenken: Stadtplanung ohne Fehler gibt es nicht. Stadtplanung bedeutet immer auch, die Narben und Fehlentscheidungen der Vergangenheit zu korrigieren.
In welchem Punkt ist Ihnen als Planungs- und Zukunftsstadtrat die Vorhersage der Zukunft besonders gut gelungen?
Görg: Mein größter und wichtigster Beitrag als Planungsstadtrat war objektiv betrachtet sicherlich die Umplanung des U-Bahn-Ausbaus. Als ich das Ressort übernommen habe, war erst kurz davor zwischen Bund und Gemeinde die Erweiterung der U1 nach Rothneusiedl und der U6 nach Stammersdorf beschlossen worden. Das war das berühmte 30-Milliarden-Schilling-Paket. Ich hatte dabei aber kein gutes Gefühl: In Stammersdorf leben bis heute verhältnismäßig wenig Menschen, in Rothneusiedl damals nahezu gar keine. Zudem hatte die riesige Donaustadt im Osten keine U-Bahn- Anbindung. Und so habe ich nach zwei Wochen im Amt zum Planungsdirektor Arnold Klotz und zur nunmehrigen Baudirektorin Brigitte Jilka, damals Leiterin der MA 18, gesagt: „Liebe Leute, das müssen wir dringend umplanen!“ Im Rückblick betrachtet war das eine sehr gute Vorwegnahme der Zukunft.
Mit welchem Gefühl blicken Sie heute auf die U2 bis zur Seestadt Aspern? Sind Sie stolz?
Görg: Nein. Stolz ist die falsche Dimension. Ich denke, wir haben mit dem U2-Ausbau in den Nordosten den absolut richtigen Pflock eingeschlagen.
Im Gegenzug: Welcher Pflock ist Ihnen weniger gut gelungen?
Görg: Ich hätte mir gewünscht, unterschiedliche Planungsressorts wie etwa Wohnbau, Verkehr oder Stadtplanung zusammenzulegen und einen übergreifenden Strategieplan für die Zukunft zu entwickeln. Das ist leider nicht passiert. Da habe ich gegen Windmühlen gekämpft.
Das Verständnis von Stadtplanung hat sich seit Ihrer Amtszeit grundlegend verändert und ist heute weitaus umfassender und interdisziplinärer. Worin konkret sehen Sie denn die Unterschiede zwischen gestern und heute?
Görg: Stadtplanung war früher deutlich planbasierter und auch planzentrierter. Heute denken wir Stadtplanung offener, prozesshafter und vor allem partizipativer. Abgesehen davon denken und agieren wir heute bewusster und weitaus sensibler, was etwaige soziale oder ökologische Konsequenzen betrifft. Die Einstellung zum Auto und zum motorisierten Individualverkehr im städtischen Raum – um nur ein Beispiel zu nennen – hat sich komplett verändert.
In den letzten Jahren gab es in der Stadtplanung viele Aufreger: Heumarkt, Mariahilfer Straße, Umgang mit dem Unesco-Weltkulturerbe. Ist die Bevölkerung kritischer geworden?
Görg: Sie ist emanzipierter geworden. Und in einer emanzipierten Gesellschaft sind Aufreger unvermeidbar. Irgendwer regt sich immer auf, und das ist auch gut so. Ich finde sogar, dass Aufreger sehr konstruktiv sind, weil sie die Bevölkerung provozieren und auf diese Weise zur Mitsprache und Beteiligung bewegen.

Nach dem Ausscheiden aus der Politik haben Sie einen gänzlich neuen Weg eingeschlagen und haben sich der Literatur gewidmet. Heute schreiben Sie Theaterstücke und Kriminalromane, die in ihren Titeln die Begriffe „Schlitzohr“, „Wendehals“ und „Würfelspiel“ tragen. Was soll uns das sagen?
Görg: Vielleicht, dass man politischen und jeden anderen Erfolg immer auch einer gewissen Schlitzohrigkeit und Wendehälsigkeit verdankt. Und bisweilen ist Politik auch ein gewisses Gambling.
Sind Ihre Kriminalromane Psychohygiene? Sind sie ein Ventil?
Görg: So habe ich es noch nie gesehen, aber das heißt nicht, dass es falsch sein muss. Die große politische Karriere ist mir ja verwehrt geblieben. Wer weiß, vielleicht sind die Bücher und Theaterstücke auch eine Entschuldigung, eine Rechenschaft vor mir selbst, weil mir genau diese Qualitäten wie etwa Schlitzohrigkeit und Wendehälsigkeit gefehlt haben. Zumindest rede ich mir das ein.
Von Ihren Lesern wurden Sie gebeten, nicht immer so nobel und zurückzuhaltend zu schreiben, sondern mehr Einblick in die Abgründe der Politik zu gewähren. Ist Ihnen das mit Ihrem letzten Roman „Dürnsteiner Puppentanz“ gelungen?
Görg: Ja. Im Dürnsteiner Puppentanz habe ich aufgezeigt, wie gewisse Aspekte in der Politik funktionieren. Man kann dieses Funktionieren gutheißen oder auch nicht, aber wenn man das nicht akzeptieren und mit seinem Wertesystem nicht vertreten kann, dann ist man in der Politik ohnehin am falschen Platz.
Am Ende war’s der Butler, der Gärtner, der Politiker?
Görg: Ich kenne zum Glück keinen Politiker, der jemals in diese Abgründe abgerutscht worden wäre.
Wovon wird Ihr nächstes Buch handeln?
Görg: Das verrate ich nicht. Jetzt, da ich Nichtpolitiker bin, nehme ich mir die Freiheit,diese Frage nicht zu beantworten.
Bernhard Görg,
geboren 1942 in Horn, studierte Latein, Geschichte und Rechtswissenschaften. Von 1968 bis 1986 arbeitete er bei IBM in Wien und Paris, die überwiegende Zeit davon als Personaldirektor. Von 1986 bis 1991 war er Geschäftsführer der Neumann-Beratungsgruppe in Wien. 1991 kandidierte er als ÖVP-Bundesparteiobmann gegen Erhard Busek, unterlag ihm jedoch. Von 1992 bis 2002 war er Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei – von 1996 bis 2001 zudem amtsführender Stadtrat für Planung und Zukunft und zugleich Vizebürgermeister von Wien. Nach dem Ausscheiden aus der Politik verfasste er Theaterstücke und Kriminalromane, darunter etwa Schlitzohren, Wendehälse und kalte Fische, Liebe Grüße aus der Wachau, Das ewige Gelübde und Dürnsteiner Würfelspiel. Zuletzt erschien Dürnsteiner Puppentanz.